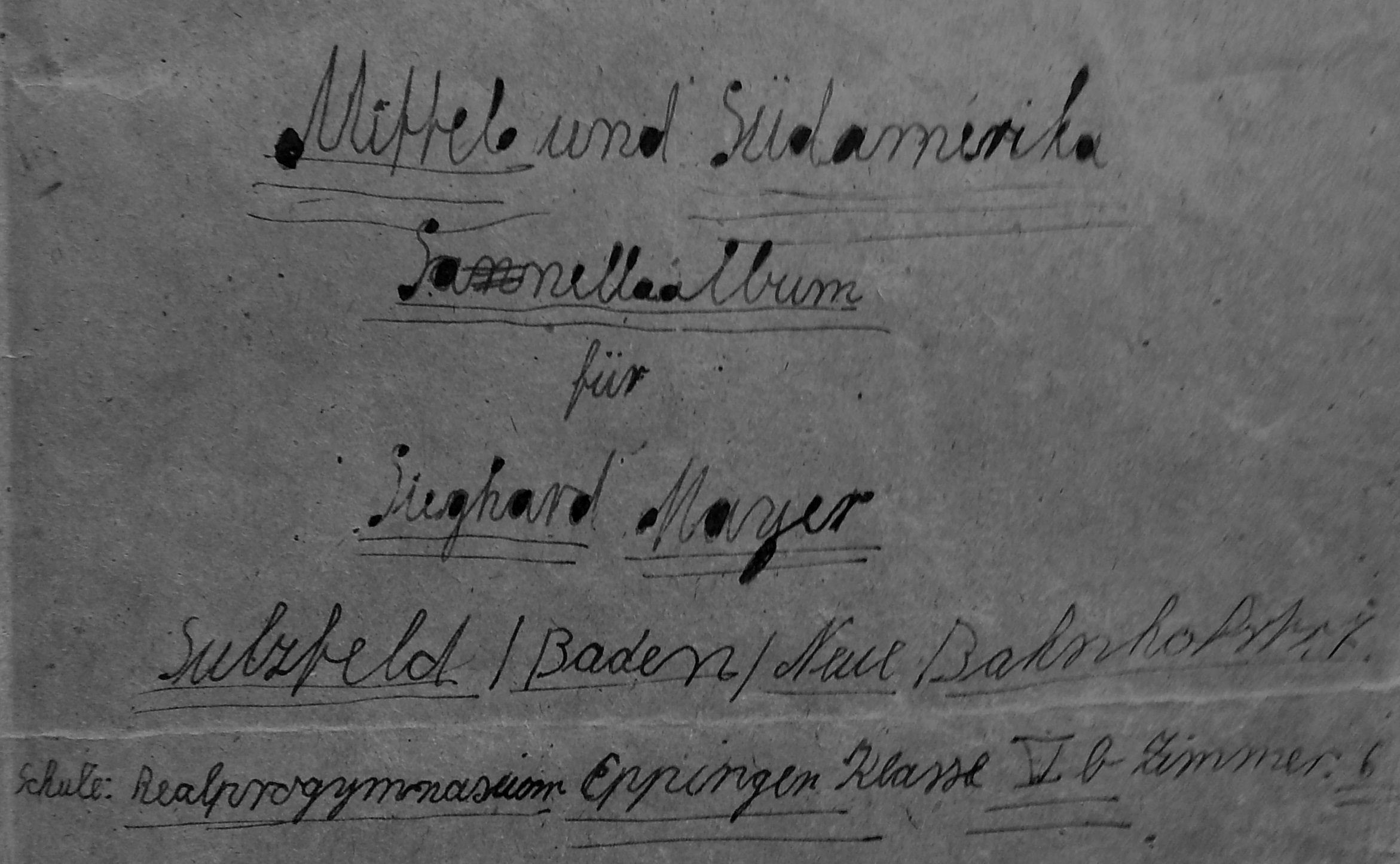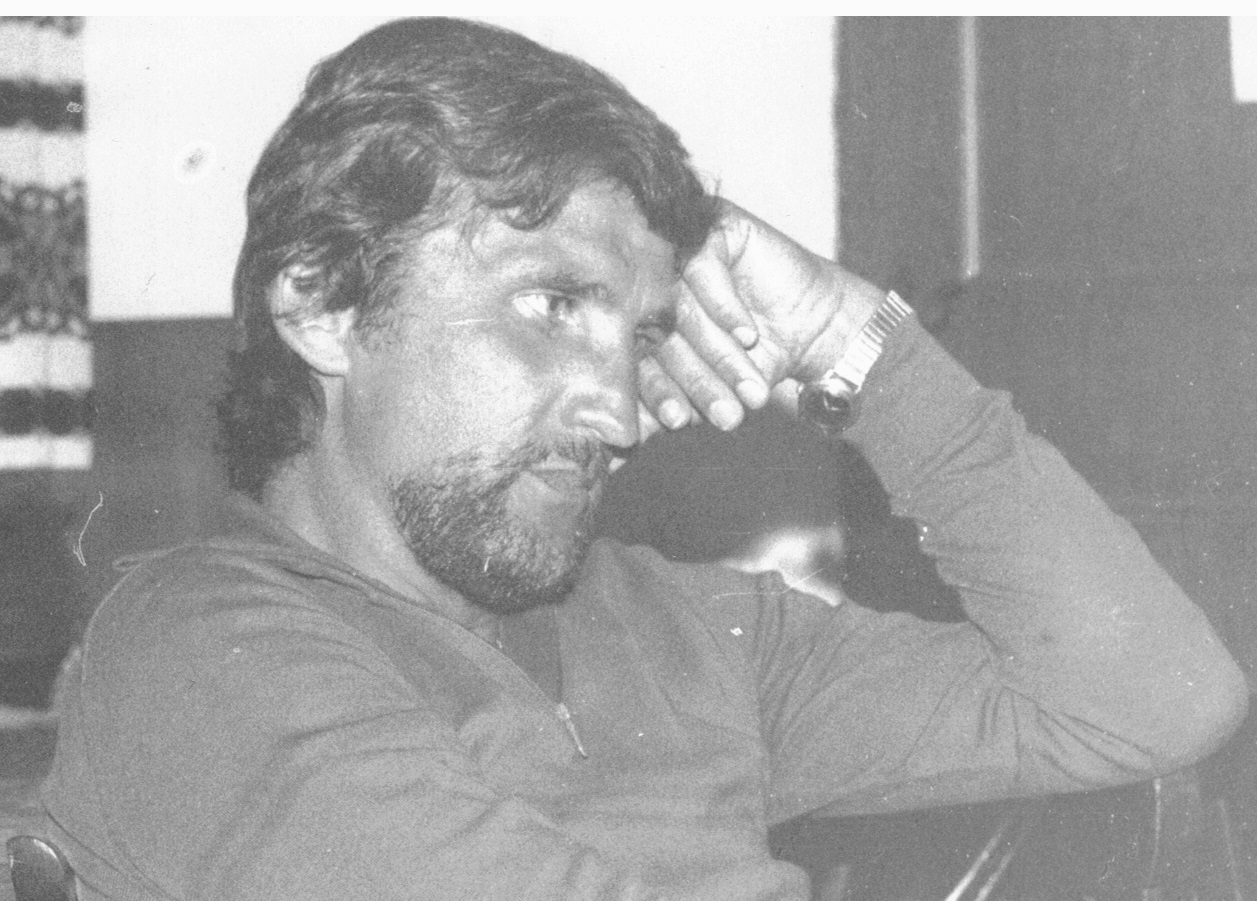- Anmerkung -
Irgendwann ergibt sich ein - oft zufälliger
- Anlass, den Blick auf Vergangenes zu werfen und mal auszuloten, was sich da
so alles angesammelt hat an Dokumenten, Bildern, Objekten, Dias, Erinnerungen
und manch Anderem, und plötzlich steht man vor einem unüberwindbar scheinenden
Berg von unzähligen Fragmenten aus all diesen Bereichen - allein etwa 32000
Bilder hat „Picasa“ gefunden.
Nach dem ersten Erstaunen - möglicherweise
auch Erschrecken - erhebt sich als Nächstes die Frage: Was soll ich damit
anfangen?
Wenn man sich dann nach reiflicher Überlegung dazu entschlossen hat, doch
manches irgendwie zu "retten", beginnt sofort der quälendste Akt dieses Vorhabens: ein
unablässig Entscheidungen verlangendes Abwägen, des Sortierens, Aussonderns,
Qualifizierens, Gewichtens und Bewertens.
Ob die nach diesen Kriterien letztendlich
entstandenen Kompromisse den ursprünglichen Qualitätsansprüchen gerecht werden,
ist schwer zu beurteilen; es bleiben immer Zweifel.
Ich habe mich aber jetzt einfach mal
entschlossen, ein paar Dinge aufzuschreiben und hoffe, dass doch nicht alles
umsonst ist.
Was soll letztendlich mit all dem passieren?
Die Antwort auf diese Frage dürfte sich
aus dem Schicksal alles Irdischen ergeben.
Januar 2019
-
Anfang -
Ich denke, es gab nicht viele Kinder in Sulzfeld - wenn überhaupt - die im Kriegsjahr 1940 und auch später in einem Krankenhaus in Karlsruhe das Licht der Welt erblickten.
Es gab Hebammen in Sulzfeld,
und die Geburt zuhause war in dieser Zeit der Normalfall.
 Wie meine Mutter es schaffte,
einen Herrn Brüstle aus Kürnbach kennen zu lernen und ihn zu bewegen - er hatte
als einer der Wenigen damals ein Auto - sie mit ihrem dicken Bauch am 14.9.
nach Karlsruhe zu chauffieren, weiß ich heute noch nicht.
Wie meine Mutter es schaffte,
einen Herrn Brüstle aus Kürnbach kennen zu lernen und ihn zu bewegen - er hatte
als einer der Wenigen damals ein Auto - sie mit ihrem dicken Bauch am 14.9.
nach Karlsruhe zu chauffieren, weiß ich heute noch nicht.
War sie ihm irgendwann
irgendwo zufällig begegnet? Hatte sie gezielt nach einer Fahrgelegenheit nach
Karlsruhe gesucht?
Wie hatte sie das Krankenhaus
gefunden, und wie hatte sie Kontakt aufgenommen - ohne Telefon und Internet?
Antworten auf diese Fragen
wird es nicht mehr geben.
Auf jeden Fall erblickte ich
am Sonntag, 15.9.1940, um die Mittagszeit das Licht der Welt, zunächst sicher
nur den Schein einer 60-Watt-Birne.
(Nach ihrer Schilderung muss
sie in der Nacht zuvor unter starken Wehen gelitten haben, aufgrund der ersten
Bombenangriffe muss aber im Krankenhaus Chaos gewesen sein, so dass sie
vergeblich um Hilfe gerufen hatte).
Als nun das Knäbchen auf der
Welt war, verweigerte es aber immer noch den Kontakt zu derselben; es atmete
nicht.
Erst nach einigen forschen
Klatschern auf das Hinterteil - mit dem Kopf nach unten hängend und durch
kräftige Hände an den Beinen gehalten - bequemte es sich zu den ersten
schreienden Lebenszeichen; ob man sie als Zustimmung oder Protest werten soll,
wird wohl nie herauszufinden sein.
Genau so wenig weiß ich, wie
lange sie mit mir im Krankenhaus war, ob sie Besuch hatte und wie sie wieder
nach Hause kam.
Jedenfalls konnten wir anfangs bei ihrer Schwester Alma in Sulzfeld wohnen; diese besaß ein kleines Haus in der Bachstraße.
Alma hatte eine einjährige
Tochter (Heidi), ihr Mann Christian war wie mein Vater ebenfalls im Krieg.
Schon nach einigen Wochen hatte sie eine
Zweizimmerwohnung im Obergeschoss des Hauses Nr.7 in der Neuen Bahnhofstraße gefunden und war mit
mir umgezogen.
Die Gründe für diesen
Wohnungswechsel sind mir nicht bekannt; möglicherweise war es zu eng geworden
in dem Haus in der Bachstraße, vor allem, wenn Christian und mein Vater Gottlob
für ein paar Tage von der Front zurückkamen.
Das Haus in der Neuen
Bahnhofstr.7 sollte dann für 28 Jahre mein Zuhause sein.
Mein Vater Gottlob Mayer hat
in meinem Leben keine Rolle gespielt. Ich habe mich mit seiner Person immer nur
sehr oberflächlich befasst - wenn überhaupt.
Persönlich sind mir nur zwei
Ereignisse bewusst, beide mit negativen Begleiterscheinungen.
Es muss um 1943 gewesen sein,
als er auf Heimaturlaub zurückkam und mir ein Dreirad mitbrachte.
Auf der Straße vor dem Haus
Nr.7 fanden die ersten Tretversuche statt, die allerdings nicht seiner
Vorstellung entsprachen, denn er schimpfte mit mir und nahm mir das Dreirad*
wieder weg.
Eine weitere schmerzliche
Erinnerung - in wörtlichem Sinne - war diese:
Immer wenn er nach Hause kam,
klebte er mit Hansaplast meine Ohren so eng wie möglich nach hinten an die
Kopfhaut.
Diese Prozedur vollzog er
jeden Tag, so lange, bis er wieder in den Krieg zog.
Über die Gründe für diese doch
beinahe abartige und schmerzhafte Maßnahme kann ich nur spekulieren. Ich denke,
dass er der Meinung war, dass ich mit meinen - minimal - abstehenden Ohren in
späteren Jahren nicht dem Prototyp eines Nationalsozialisten entsprechen und so
ein Schandfleck in einem Reich sein könnte, das doch 1000 Jahre halten sollte -
mindestens.
*Später
entpuppte ich mich als Meister auf diesem kleinen Gefährt, sehr zum Leidwesen
von Sophie, der Frau unseres Vermieters Karl Himmel, denn ich fuhr stundenlang
kreuz und quer durch unsere Küche/unser Wohnzimmer und erst, wenn ihr Klopfen mit
dem Strupfer an die Zimmerdecke immer noch keinen Erfolg zeitigte, kam sie nach
oben und nahm mir das Dreirad weg. Meistens brachte sie es aber kurze Zeit später wieder, begleitet von nicht
allzu ernst gemeinten Ermahnungen. Sie war eine gute Frau, die viel zu früh
sterben musste.
Gottseidank kam es nicht dazu
- 12 Jahre waren schon 12 zu viel.
In seiner Uniform und mit
seinem Säbel muss er eine imposante Erscheinung gewesen sein, wie ich oft
später in Sulzfeld und in seiner Heimatgemeinde Sternenfels von vielen bestätigt
bekam.
Er war 1912 in Sternenfels zur
Welt gekommen und schlug sich nach Abschluss der Volksschule mit
Gelegenheitsarbeiten durch (eine Zeit lang arbeitete er in einer Filiale der
Hohner-Werke in seinem Dorf).
Hitler und seine Nazis müssen
ihn fasziniert haben, so dass 1933 sein Eintritt in die Wehrmacht als
"Zwölfender" nicht verwundert (oder wollte er doch nur der
Arbeitslosigkeit entkommen?).
Er muss meine Mutter sehr
geliebt haben; aus seinen vielen Briefen von der Front ist zwischen den Zeilen
eine tiefe Zuneigung zu spüren. Immer wieder spricht er ihr Trost zu und
ermuntert sie, doch standhaft zu bleiben, auch im Vertrauen auf den Führer.
Sicherlich wusste er, wie schwer es für sie war, zwei Kinder - im September
1942 wurde meine Schwester Elke geboren - in einer Umgebung zu versorgen und
großzuziehen, in der der alltägliche Mangel immer mehr das Leben erschwerte.
Im November 1944 stand ein
Mann vor unserer Tür, dem sogar ich mit meinen vier Jahren auf Anhieb ansah,
dass er nichts Gutes brachte.
Den Brief, den er wortlos
meiner Mutter übergab, habe ich heute noch.
Es war das einzige Mal, dass
ich meine Mutter zusammenbrechen sah; die Erinnerung an ihr Schluchzen und
Weinen hat mich viele Jahre begleitet.
Er war in Belgrad ums Leben
gekommen.
Zwei Versionen über seinen Tod
wurden mir unterbreitet:
Ein Mann aus Zaberfeld, der
ihn gekannt hatte und der nach dem Krieg wieder nach Hause kam, erzählte mir,
dass mein Vater während eines nächtlichen Kontrollganges in den Straßen von Belgrad
aus einem Keller heraus von
Partisanen erschossen wurde.
Meine Mutter erzählte mir,
dass er wieder mal im Lazarett lag und bei einem Bombenangriff ums Leben
gekommen war. Er sei bereits in Sicherheit gewesen, entschloss sich aber dann,
den Bunker zu verlassen und beim Transport von kranken Kameraden aus ihren
Zimmern zu helfen. Dabei sei er dann gestorben.
Ich tendiere zur ersten
Version, habe dabei aber Angst, meinem Vater Unrecht zu tun.
Meine Mutter könnte mit ihrer
Schilderung - möglicherweise unbewusst - die Absicht gehabt haben, in ihrem
Sohn den Vater als Heros zu verankern, sein Bild zu idealisieren.
Ich habe sie später oft zu
einem Besuch seines Grabes in der Nähe von Belgrad zu überreden versucht - ohne
Erfolg. Gründe dafür nannte sie nie.
Meine Mutter Frieda (oft auch Fridl genannt) wurde 1914 in Ochsenburg geboren und wuchs zusammen mit zwei älteren Schwestern auf, Alma und Rosa, wobei letztere - wie es ich erst achtzig Jahre später herausstellen sollte - einen anderen Vater hatte.
Ihre Eltern Julius und Anna
Wezstein mühten sich in Ochsenburg mit einer kleinen Landwirtschaft durchs
Leben; im Winter verdingte sich der Vater als Steinhauer in den Mühlbacher
Steinbrüchen, um durch seinen Lohn die finanzielle Situation etwas zu
entspannen.
Wie mir später viele ihrer
Schulfreunde bestätigten, galt sie in der Schule als "gescheit“; der
Lehrer übertrug ihr in seiner Abwesenheit kleinere Aufgaben.
Nach der siebenjährigen
Schulzeit bekam sie eine Arbeitsstelle bei der Textilfabrik "Bleyle“ in
Brackenheim.
Zehn Jahre lief sie jeden Tag früh am
Morgen die zwei Kilometer zum Bahnhof nach Zaberfeld hinunter und abends wieder
zurück - im Winter wie im Sommer; das Zabergäu-Dampfbähnle verband Zaberfeld
mit Lauffen.
Den noch von damals
vorhandenen Bildern nach, dürfte sie ihren späteren Mann Gottlob Mayer etwa im
Alter von 18 Jahren kennengelernt haben.
Um die Jahreswende 1939/40
muss sie schwanger geworden und zu ihrer Schwester Alma nach Sulzfeld gezogen
sein.
Was weiß ich noch aus dieser
Zeit?
Meine Mutter hatte es oft sehr
schwer, uns mit dem Nötigsten zu versorgen.
Ich erinnere mich noch, dass
wir im Winter bei tiefem Schnee zu einem Bauern nach Rohrbach
hinüberüberstapften, um dort etwas Milch zu bekommen. In der Bauernstube stand
ein seltsames Gefäß, das ich später als Butterfass kennenlernen sollte.
Ansonsten bekamen wir von den
Bauern in Sulzfeld Milch und Eier, weitere Lebensmittel konnten wir mit unseren
"Märklen" in den verschiedenen Läden kaufen.
Auch waren wir oft in der
Bachstraße bei Almatante (ihr Mann Christian kam 1946 leicht verletzt aus dem
Krieg zurück) und ihren Kindern (1943 kam noch Volker in die Familie).
Machte sich der Krieg sonst
noch bemerkbar?
Sicher.
Als die Bombenangriffe 1945 an
Häufigkeit zunahmen, wurden unsere Betten und einige sonstige Möbel in den
Keller verfrachtet. Viele Wochen lebten wir dort unten (mein Bett stand unter
der Treppe im "Kohlenkeller").
Pünktlich um 20 Uhr tauchte
der "Bombenkarle" auf, zog ein paar Schleifen über Sulzfeld und
verschwand wieder.
Wenn tagsüber die Sirenen bei
einem Fliegerangriff ertönten, suchten wir meistens Unterschlupf im gewölbten
Keller bei der benachbarten Bauersfamilie Pfefferle.
Ich kann mich an drei
Bombeneinschläge in unserem Dorf erinnern: einem Haus am südlichen Ende der
Neuen Bahnhofstraße wurde der Ostteil weggerissen, ein Haus in der
Ochsenburgerstraße wurde völlig zerstört, und am Bedrohlichsten für uns wurde
es, als eine Bombe den Westteil des Bahnhofs zertrümmerte (er ist nur ca. 100 m
Luftlinie von unserem Haus entfernt); der Einschlag, der Explosionsknall und
die darauffolgende Erschütterung trafen uns alle bis ins Mark.
Der Eisenbahntunnel zwischen
Sulzfeld und Eppingen war ein beliebtes Ziel für die Jagdbomber, denn in ihm hatten
sich oft Munitionszüge der Wehrmacht versteckt; bei Nacht konnten sie aber
immer unbeschädigt entkommen.
Bei länger andauernden
Bombendrohungen verließen wir unser Haus und zogen mit unserem vollgepackten
Leiterwagen durch das Dorf und am Kohlbach entlang Richtung Gärtnerei
Pfettscher.
Dort nächtigten wir dann auf
den baumbestandenen Wiesen nahe der "Kelter", auf dem Gewann, auf dem
unser jetziges Haus steht.
Ich kann mich gut an die
Lichtfinger der Flakabwehr erinnern.
1945 nahm auch die Zahl der
Menschen ("Fuggerer") aus den Städten immer mehr zu. In ihrer Not
versuchten sie, oft sehr Wertvolles gegen Kartoffeln, Mehl und Butter
einzutauschen.
Nicht wenige Bauern dürften
damals ihr Vermögen beträchtlich vermehrt haben.
Im Frühjahr 1945 konnten wir
aus unserem Speicherfenster beobachten, wie Soldaten beiderseits des
"Rohrbacher Buckel" in den Straßengräben auf das Dorf zurobbten.
Sie stellten sich später als
Marokkaner heraus, die aber das Dorf bald wieder verließen.
Ihnen folgten die Amerikaner, und wir
lernten Wörter wie "Chewing Gum" und "Ok" kennen, auch
stieg uns zum ersten Mal in unserem Leben der Duft einer Orange in die Nase.
Die Soldaten waren freundlich
zu uns Kindern und hoben uns manchmal in ihre mächtigen Fahrzeuge.
Sie hatten die schönsten
Häuser in unserem Dorf einfach beschlagnahmt.
Ihre Anordnung, alle
Wertgegenstände auf dem Rathaus abzugeben, wurde nur von den Ängstlichsten
befolgt. So landete auch unser wunderschönes Telefunken-Radio dort (zwanzig
Jahre später entdeckte ich es bei einem reichen Sulzfelder).
Viele vergruben auch ihren
Schmuck und Uhren oder lagerten sie in geleerte Fässer ein.
Auf dem Schulhof lagen Berge
von Gewehren, Pistolen und Munition jeder Art (einige Schachteln davon habe ich
erst in den 1980-er-Jahren entsorgt).
Als dann die ersten
Care-Pakete eintrafen, war das Schlimmste überstanden, die Zukunft wagte sich
aus den Startlöchern.
Im Vergleich zu dem großen,
unermesslichen Elend, das der Krieg im in Europa verursacht hatte, konnten wir
uns glücklich schätzen, dass wir vor diesem verbrecherischen Wahnsinn in
unserem Dorf doch weitgehend verschont geblieben waren, aber umso fassungsloser
und bestürzter muss man erkennen, dass aktuell manches - vielleicht sogar
vieles - darauf hindeutet, dass vergleichbare Strukturen und Denkweisen
vergangener Jahrzehnte immer mehr an die Oberfläche kommen und sich erneut
in den Köpfen Unbelehrbarer - oder präzise Wissender und Berechnender - breit
machen und etablieren.
"Homo sapiens"? - Man kann daran
zweifeln!
Wie bereits an anderer Stelle
erwähnt, wohnten wir - meine Mutter, ich - und ab September 1942 auch meine
Schwester Elke - ab Ende 1940 in einer Zweizimmerwohnung im Obergeschoss des
Hauses Neue Bahnhofstraße 7.
Es war
ein Doppelhaus, dessen linke Hälfte Karl Himmel gehörte; er hatte es zusammen mit seinem Bruder
Heinrich im Jahr 1926 gebaut. Dieser bewohnte mit seiner Familie die rechte
Hälfte.
Karl
Himmel musste auf Grund seines Alters (*4.7.1899) nicht mehr in den Krieg. Er
hatte den 1. Weltkrieg mitgemacht, war 1917 in französische Gefangenschaft
geraten und 1919 nach Hause zurückgekehrt.
Als
1946 seine Frau Sophie starb, stand er plötzlich alleine da mit seinen beiden
Töchtern Helga und Gudrun.
1948
geschah dann das, was zu erwarten war: Meine Mutter und er taten sich zusammen
und heirateten im Januar.
Ein
Zusammenleben ohne Trauschein im selben Haus ließen die damaligen Moralvorstellungen nicht zu; der
Trauschein "besänftigte" einige Nachbarinnen.
Geprägt
war diese Ehe von gegenseitigem Respekt und viel Arbeit.
Obwohl ich im Rückblick auf das Verhalten
meiner Mutter mir gegenüber vieles missbillige, habe ich vor ihrer
Lebensleistung höchsten Respekt.
Aufgewachsen
in ärmlichen Verhältnissen, nach der Schule zehn Jahre jeden Tag von Ochsenburg
nach Leonbronn gelaufen und mit dem Zug zur Arbeit nach Brackenheim gefahren,
1939 geheiratet und vier Jahren nach dem Tod des Ehemannes mit
zwei Kindern die Härten eines Krieges bestanden und dann ab 1961
nahezu 30 Jahre lang einen Haushalt mit acht Personen gemeistert -
genauer: jeden Tag Essen zubereiten, Wäsche besorgen, Haus in Ordnung halten
und nebenbei noch drei Kinder ihrer Tochter großziehen: eine aufopferungsvolle,
alle eigene Interessen verleugnende Arbeit, die man in ihrer Dimension heute
nicht mehr begreifen kann. 1996 musste sie dieser Schinderei Tribut zollen; ihr
Herz wollte/konnte nicht mehr.
Bei
der Erziehung von uns Kindern machten beide keinen Unterschied.
Mir
gegenüber war Karl sehr streng, schlug mich aber nie, was damals die Ausnahme
war. Seine bestimmte Art und Weise verlangte einfach Gehorsam.
Ich
musste ihm bei den mannigfaltigsten Arbeiten zur Hand gehen und habe dabei eine
Menge im handwerklichen Bereich von seinem Geschick profitiert. Lob sprach er
selten aus, seine Ungeduld war neben seiner peniblen Arbeitsweise ein weiteres
Markenzeichen.
Er
hatte viele Jahre bei den NSU-Werken Fahrräder zusammengebaut.
Um
nach Neckarsulm zu gelangen, musste er morgens um vier Uhr losmarschieren, wenn
er in Eppingen den 6-Uhrzug erreichen wollte.
Derselbe
Weg musste natürlich abends wieder bewältigt werden, und das Ganze sommers wie
winters.
Vor
allem die - damals noch schneereichen Winter - müssen brutal gewesen sein.
Nach dem Krieg wurde er bei der Eisenbahn
angestellt.
Zuerst
als Sipo ("Sicherheitsposten") beim durch Bomben beschädigten Tunnel
zwischen Sulzfeld und Eppingen, später als Schrankenwärter bei den
verschiedenen Bahnübergängen rund um Sulzfeld.
Ich
musste ihm um die Mittagszeit sein Essen bringen.
Wenn
er beim "Graser" Dienst tat, musste ich durch den Tunnel stapfen, was
mich anfangs große Überwindung kostete.
Etwa
zehn Jahre nach dem Krieg wurden die meisten Bahnübergänge geschlossen oder
automatisiert, und er wurde einer Rotte zugeteilt.
Es war
eine schwere Arbeit, jeden Tag acht Stunden bei jedem Wetter mit einem Pickel
die Schottersteine zwischen den Gleisen zu lockern.
Ich
denke, es war um das Jahr 1956, als er von seinem Rottenführer das Angebot
bekam, sich selber für diesen Posten ausbilden zu lassen. Dieser hatte seine
akkurate Arbeit gesehen.
Nach
langem Zögern nahm er diese Offerte an, fuhr ein halbes Jahr jeden Tag nach
Pforzheim und drückte als knapp Sechzigjähriger nochmals die Schulbank.
Es war
auch die Zeit, wo er zum ersten Mal merkte, dass mein Wechsel aufs Gymnasium
doch nicht so ganz unsinnig gewesen war. Zugegeben hat er seinen evtl.
Sinneswandel nicht, aber froh war er doch, dass ich ihm bei seinen
Matheaufgaben helfen konnte.
Bis
zum Ende seines Arbeitslebens bei der Eisenbahn begleitete er den Posten des
Rottenführers und hatte es damit etwas leichter. Es kam aber immer wieder vor,
dass er jemanden den Pickel aus der Hand nahm und ihm demonstrierte, wie seiner
Meinung nach richtige Arbeit auszusehen hat.
Alle
seine Tätigkeiten wurden schlecht bezahlt, so dass Schmalhans immer
Küchenmeister bei uns war.
Eine
kleine Erleichterung brachte die Rente*, die meine Mutter nach dem Tod meines
Vaters bezog.
Der
Lohn wurde damals wöchentlich bar ausgezahlt.
Ich
kann mich noch gut erinnern, wie mich meine Mutter immer freitags ab 15 Uhr zum
"Bahnhofbuckel" schickte, um nachzuschauen, ob "er" noch
nicht zu sehen war. Gemeint war der Mann mit der Ledertasche, aus der er in
unserer Küche den Lohn bar auf den Tisch zählte.
Meiner
Erinnerung nach waren es etwa 100 Mark, nicht üppig für 6 Menschen.
*Wenn
sie ohne Trauschein zusammengelebt hätten, hätte die dann fällige Rente meines
Vaters Gottlob ("Zwölfender") nahezu das Fünffache ausgemacht, was
Karl verdiente; er hätte praktisch zuhause bleiben können. Nach der Heirat
schrumpfte sie auf ca. 60 Mark im Monat zusammen.
Ohne
die kleine Landwirtschaft wäre es nicht zu schaffen gewesen.
Sie
trug auch dazu bei, dass wir jedes Jahr ein oder zwei Schweine großziehen
konnten.
Kartoffel
und Geschrotetes (Schalen der Getreidekörner) waren ihre Hauptnahrung.
Ihre
"Wartung" oblag mir.
Das
bedeutete, jeden zweiten Tag die Schweine aus dem Stall zu treiben, den Mist
zusammenzufegen und rauszuschaffen, frisches Stroh vom Schopfen heruntergabeln,
einstreuen und die Biester wieder in den Stall zu scheuchen, was oft mit viel
Mühe und Geschrei verbunden war.
Nahezu
jeden Tag musste ich einen Korb Kartoffeln aus dem Keller holen, die Triebe
abzupfen und sie im Kessel abkochen.
Der
Brei aus Kartoffeln und Kleie wurde dann mit Wasser - selten einmal mit Milch -
gemischt und in den Trog geworfen. Das Schmatzen und Grunzen der beiden höre
ich heute noch.
Neben
Schweinen hielten wir über Jahre auch Hühner und Ziegen, phasenweise auch
Gänse, Enten und Hasen.
Die
Ziegen brauchten im Sommer jeden Tag frisches Futter, dessen Besorgung mich
abends meistens aus der Tätigkeit rausriss, die mir am liebsten war:
Fußball spielen.
Zu
jeder Tageszeit fanden wir uns zu dieser Bolzerei auf der Neuen Bahnhofstraße
oder auf der Luisenstraße ein.
Anfangs
(1948) mussten wir unseren "Ball" selbst basteln; meistens war es
eine mit Stroh gefüllte und mit Stofftüchern oder Weidenruten umwickelte Kugel.
Nach einer Stunde war sie meistens zerfetzt.
Später
konnten wir Gummibälle verwenden; der Besitzer des Balles war der
"Chef". Er bestimmte, wer mitspielen durfte, ebenso Beginn und Ende
des Spiels.
Wenn
der Ball über ein Hoftor flog, konnte es sein, dass der Hausbesitzer den Ball
zum Ortspolizisten, Herrn Weber, brachte, und einer von uns dann diesen
Canossagang in die Friedrichstraße auf sich nehmen musste, um den Ball wieder
abzuholen; ohne eine lange und intensive Strafpredigt kam er nicht davon,
ebenso ohne das feste Versprechen, in Zukunft auf dem Sportplatz rumzubolzen
und nicht auf den Straßen (dieses immer wieder nicht zu haltende Versprechen
war auch der Grund, warum jedes Mal ein anderer von uns in die Friedrichstraße
geschickt wurde).
Das
Schlimmste, das uns passieren konnte, war, dass der Ball in den Hof der
Hausnummer 11 flog, denn hier hauste der "Schneiderbock", ein
meistens betrunkener Einzelgänger.
Er
hatte immer das Beil und den Hackklotz parat, und äußerst selten gelang es
einem von uns, über das verschlossene Hoftor zu klettern und den Ball zu
retten.
[Nebenbei:
Es gab keinen Grund, den weiten Weg zum Sportplatz anzutreten. Auf der
"Bäreninsel" gab es bis weit in die 50-er nur zwei Autos, die selten
benutzt wurden und meistens in ihren Garagen standen. Heutzutage gibt es kaum
ein Durchkommen, spielende Kinder auf den Straßen gibt es nicht mehr.]
Nachdem
mein Vater nach Rückkehr von der Arbeit zu Abend gegessen hatte, musste ich den
Leiterwagen mit einem Grastuch, der Sense und dem großen Rechen beladen und ihn
dann durch die Neue Bahnhofstraße und die Friedrichstraße zu unserem kleinen
Grundstück hinter der Ziegel Pottiez hinausziehen; mein Vater hatte die
Abkürzung über den schmalen Fußweg, an der Firma Burgahn vorbei, genommen.
Wir
trafen uns auf dem ca. 3 ar großen Wiesenstück, und er schnitt mit der Sense
die notwendige Menge Gras, um das Grastuch zu füllen.
Wir
verstauten alles auf dem Leiterwagen und waren nach etwa einer Stunde wieder zu
Hause.
Wenn
ich Glück hatte, war die Bolzerei noch im Gange, und ich konnte bis Einbruch
der Dunkelheit noch mitmischen.
Einer
der wichtigsten Tage für uns alle im Laufe des Jahres war der Tag, an dem eines
unserer Schweine geschlachtet wurde; meistens fand dieses Ereignis im Frühjahr
statt, in der Regel an einem Samstag.
Schon
Tage vorher begannen die Vorbereitungen:
Mit
dem Metzger - meistens war es Hans Meergraf - wurde der Termin vereinbart, und
bei Hans Klebsattel vom "Badischen Hof" wurde die Brühmulde abgeholt
und mit dem Leiterwagen zum Haus transportiert; die Schaber und Kratzer gab er
uns gleich mit.
In die
Küche wurde ein zweiter Tisch gestellt, und alle unnötigen Möbelstücke wurden
rausgeschafft. Die Küche sollte als Zentrum dieser blutigen und fettstrotzenden
Zeremonie fungieren.
Als
der Metzger am Schlachttag bereits sehr früh mit seinen Werkzeugen eingetroffen
war, wurde das Schwein unter großem Geschrei aus dem Stall geschafft und im Hof
auf die Erde gelegt; durch beruhigendes Zureden versuchte man, das Tier zu
besänftigen.
Dann
wurde es getötet.
Bei
den ersten Hausschlachtungen nach dem Krieg - sie waren während desselben
strengstens verboten gewesen - wurde das Schwein mit einer Kugel aus einer vom
Krieg übrig gebliebenen P38 in den Kopf getötet.
Bevor
der Metzger ab der fünfziger Jahre seinen Bolzenschussapparat mitbrachte,
starben die Schweine auf eine äußerst grausame Art.
Der
Metzger oder mein Vater stellten sich breitbeinig über das am Boden liegende
Schwein und versuchten, es in einem ruhigen Moment durch einen Schlag auf die
Stirn mit der stumpfen Seite einer Axt zu betäuben.
Wenn
der Schlag die Stirn des Schweines mittig traf, war es sofort bewusstlos und
konnte gestochen werden.
Oft
waren mehrere Schläge nötig, um das Tier zu betäuben; heute ein unvorstellbar
barbarischer Akt.
Ob
bewusstlos oder tot:
Der
Metzger stach dann mit einem langen Messer in den Hals des Schweines und
zertrennte die Halsschlagader.
Das
herausströmende Blut wurde in einem Eimer aufgefangen und sofort mit einem
Löffel minutenlang kräftig umgerührt. So wurde die Gerinnung verhindert und das
Blut für die spätere Verwendung haltbar gemacht.
Wenn
das Schwein ausgeblutet war, wurde es in die mit kochend heißem Wasser gefüllte
Brühmulde gehievt und in mühevoller Arbeit mit scharfkantigen Schabern von
Haaren und Borsten befreit.
Anschließend
wurde ein Strick durch die aufgeschlitzten Achillessehnen der Hinterbeine gezogen
und das Tier an einem in der Stallwand eingelassenen massiven Metallhaken mit
der Bauchseite nach vorne hochgezogen.
Der
Bauch wurde anschließend aufgeschlitzt, und die Organe sorgfältig herausgelöst;
außer der Galle wurde nahezu alles verwendet.
Leber,
Nieren, Herz, der Kopf und weitere Teile wurden in die Küche geschafft und dort
von meiner Mutter und anderen Frauen zerkleinert und für die weitere Verwendung
vorbereitet.
Eine
der umfangreichsten Arbeiten war das Speckschneiden:
Die
Speckschwarten mussten für die Wurstherstellung in kleine Würfel
("Grieben") geschnitten werden, bevor sie in kochendes Wasser
geschüttet wurden.
Manchmal hatte ich Pech und musste eine
der unbeliebtesten Arbeiten übernehmen: Das Reinigen des meterlangen Dick-und
Dünndarmes. Er wurde für die Wurstfüllung unbedingt gebraucht, ebenso wie der
Magen ("Schwartenmagen").
Nachdem
ich zunächst den Kot aus dem Darm herausdrückte, wurde er mehrmals mit Wasser
so lange gespült, bis das herausfließende Wasser ganz klar war.
Nach
etwa fünf bis sechs Stunden gab es als Belohnung der anstrengenden Arbeit die
von allen erwartete und beliebte Kesselbrühe ("Metzelsuppe"),
manchmal auch noch "Kesselfleisch".
Anschließend
wurden dann die verschiedenen Wurstsorten (Leberwurst, Blutwurst/Griebenwurst,
Schwartenmagen) zuberei- tet, in die Därme bzw. den Magen abgefüllt und
im „Wäschkessel“ stundenlang gekocht (zur Verfeinerung und Geschmacksabrundung
wurden noch einige Kilogramm zuvor gekauftes Rindfleisch beigemischt).
Besonders
sorgfältig wurden Schweinerippchen und der Schinken zubereitet.
Letzterer
wurde Tage später - nach der Lufttrocknung - im Kamin geräuchert; das dafür
notwendige Sägemehl hatte ich beim "Schreinerweiß" besorgt.
Am
späteren Nachmittag war es dann Zeit, die tags zuvor bei der
"Eduarde" geholten und inzwischen mit Wurst und Fleisch gefüllten
Dosen in einen Wäschekorb zu verstauen und mit dem Leiterwagen in die
Friedrichstraße zu fahren, wo sie dann von ihr maschinell mit einem Deckel
verschlossen wurden.
Mit kleinen Metallstempeln wurden auf die
Deckel entsprechend des Inhalts Großbuchstaben eingestanzt (G, L, F, S).
Auch
diese Dosen mussten dann einige Stunden bei kochendem Wasser im „Wäschkessel“
aushalten.
Während
der Metzger schon lange nach Hause gegangen war, und mein Vater und ich vor dem
„Wäschkessel“ saßen und das in ihm steckende
Thermometer kontrollierten, blieb für die Frauen noch eine harte Arbeit
übrig:
Böden,
Möbel, Werkzeuge und Geschirr mit kochendem Wasser von den sich überall breit
gemachten Fettrückständen zu befreien.
In
einem einzigen Arbeitsgang war das nicht zu bewerkstelligen; erst nach Tagen
waren die Spuren dieses "Schlachttages" einigermaßen verschwunden,
aber noch Wochen und Monate dauerte es, bis die Leckereien dieses Tages
aufgebraucht waren und man sich aufmachte, die nächste Hausschlachtung zu
planen.
Ich
hauste damals im kleinsten Zimmer des Hauses, und die nächsten paar Tage fühlte
ich mich wie im Schlaraffenland, denn dieses acht Quadratmeterstübchen war
schon traditionsgemäß als Aufbewahrungsort für die "Ernte" des
Schlachttages auserkoren.
Sie
hingen an fünf Weinbergpfählen, die man links und rechts auf zwei Stühle gelegt
hatte, und es kostete mich abends schon einige Mühe, mein Bett aufzusuchen,
ohne ein allzu großes Durcheinander an den baumelnden Würsten und Schinken
anzurichten.
An die
Gerüche musste ich mich jedes Jahr wieder neu gewöhnen.
- Bäreninsel -
Eine
genaue Begriffsbestimmung für diesen nördlichen Sulzfelder Ortsteil habe ich
nirgends gefunden. Ich definiere ihn einfach als dieses Gebiet:
Das
Gelände innerhalb der Neuen Bahnhofstraße, der Bahnhof- straße, der Hauptstraße und
der Friedrichstraße.
Auch
der Ursprung dieses Begriffes war nicht eindeutig zu eruieren. Am Plausibelsten
erscheint mir noch die Erklärung, dass die mitgeführten Bären des „Fahrenden
Volkes“, das hier manchmal - in der Nähe des Bahnhofs - sein Lager aufschlug,
diesem Flecken seinen Namen gaben.
Andere
vermuten, dass der Begriff "Beeren“ Namenspate war.
Wie
dem auch sei, diese wenige Hektar unseres Planeten waren viele Jahre meine
„Welt“; hier wuchs ich auf, kannte jeden Winkel, und heute noch tauchen bei
jedem Besuch unzählige Bilder und Erlebnisse auf.
Ich
habe schon viele Definitionen des Wortes „Heimat“ gelesen (u.a. bei Siegfried
Lenz), und immer wieder bin ich geneigt, diese „Bäreninsel“ als den Urpol
meiner Heimat zu sehen.
In
den bis jetzt 50 Jahren, die ich im „Ballreich“ lebe, hat sich dieses Gefühl
noch nicht eingestellt.
So
um die Zeit ab 1950 erweiterten wir Schritt für Schritt diesen Raum und waren
immer öfter auch am Kohlbach, im Hägenich, auf der Ravensburg, im Forlen- und
Rietwald zu finden.
Wer
waren „Wir“?
In
der Regel eine Gruppe von sechs bis zehn nahezu gleichaltriger Buben, denen
sich manchmal auch zwei oder drei Mädchen zugesellten.
Die
meiste Zeit trafen wir uns auf der Kreuzung der Luisen-/Neuen Bahnhofstraße und
verweilten uns bei den mannigfaltigsten Spielen (Verstecken, Völkerball,
"Steckele gestohlen“, Handball und vor allem
Fußball/"Rasserle").
In
den Wäldern dominierte das "Indianer spielen", vor allem, als ich um
1952 bereits alle mir zur Verfügung stehenden "Karl-May-Bücher"
gelesen hatte (mein erstes Buch - Nibelungensage" - hatte mir
mein taubstummer Nachbar Helmut geliehen).
Auf der unteren Kohlbach ließen wir unsere
geschnitzten Schiffchen treiben, bis sie bei der "Egon-Mühle" den
Wasserfall hinunterstürzten.
Beeinträchtig
wurde unser Rumtoben auf den Straßen durch keinerlei motorisierte Vehikel,
allenfalls mussten wir dann kurz unterbrechen, wenn Bauer Pfefferle mit seinem
Pferdegespann zu einem Acker hinauszog (heute sind beide Straßen mit Autos
völlig zugeparkt).
Eine
weitere Attraktion bildete ab 1954 das "Badhäusle" für uns.
Der
vor dem Krieg gehegte Plan des Baus eines Freischwimmbades („Hitlerbad“) in der
Nähe der Gärtnerei "Pfettscher" hatte sich anscheinend als nicht
realisierbar erwiesen, aber um der Dorfjungend doch Gelegenheit zu bieten, sich
an heißen Sommertagen ab und zu etwas Kühlung verschaffen zu
können, hatten Gemeindearbeiter gegenüber der
heutigen E.G.O. den Kohlbach verbreitert und das entstandene Becken mit einer
Betonmauer eingefasst; für den Durchfluss des Baches hatte man eine etwa 1x2m
große Lücke frei gelassen. Die darin hochkant stapelbaren Bretter stauten
den Kohlbach zu einem etwa 10x4x1,40 m Becken, das uns in den Sommermonaten als
"Lehrschwimmbad" diente; viele Kinder lernten in ihm das Schwimmen.
Ein
einziger Nachteil schränkte unsere Badefreuden allerdings doch beträchtlich
ein: Das Wasser des aus dem Ochsenburger Wald herunterfließenden Kohlbachs war
zu kalt zum "Baden"; man sprang hinein, "strampelte" auf
die andere Seite und stieg sofort wieder heraus.
Hatten
wir das „Paradies“? Konnten wir nur spielen?
Mitnichten.
Wie
an anderer Stelle bereits erwähnt, wurden manche von uns ab dem Alter von neun
bis zehn Jahren zu vielfältigen Arbeiten herangezogen, ob im häuslichen Bereich
oder bei der Feldarbeit.
Zuhause
musste ich unsere Schweine füttern und alle zwei Tage ihren Stall ausmisten,
die Hühner und in manchen Jahren die Ziegen versorgen, Holz spalten, samstags
die „Rinne“ fegen, die Brotlaibe zum Bäcker fahren und abends wieder abholen
(im Sommer mit dem Handwagen, im Winter mit dem Schlitten), mit dem Wassereimer
ein- bis zweimal am Tag zum Bahnhof oder zum „Bienenheinrich“ marschieren und
aus dem Brunnen Trinkwasser pumpen (das Leitungswasser war zu kalkhaltig), und
einige Male in der Woche schickte man mich zum Bäcker Hagenbucher, zum
„Klebsattel“ (Metzger) oder zum „Konsum“ im Oberdorf zum Einkaufen (von der
Inhaberin des im Nachbarhaus befindlichen „Kolonialwarenladens“ - Frau Kunzmann
-höre ich heute noch ihren Standardsatz: „Hab i nett, s`Auto isch noch nett
komma“; sie konnte die angelieferten Waren meistens nicht bezahlen und erhielt
so immer weniger).
Ab
1952 kam es immer häufiger vor, dass ich nach der Heimkehr aus dem Progymnasium
auf dem Küchentisch einen Zettel vorfand, der mich darüber informierte, auf
welchem Acker des Onkel Augustschen Besitztums ich meinen Nachmittag verbringen
sollte.
Wie
an anderer Stelle geschildert, liehen wir für die Arbeit auf unseren
Feldern und im Weinberg einige Male im Jahr das
Kuhgespann von August Krüger in der Bachstraße aus; er war der Schwager meines
Vaters, und er erwartete natürlich, dass diese „Dienstleistung“ von uns in
irgendeiner Form honoriert wurde. Da uns eine finanzielle Entgeltung nicht
möglich war, war die Alternative nur die Einbringung dessen, was wir hatten:
unsere Arbeitskraft. Meine Mutter trug dabei die Hauptlast.
Immer
wieder trieb es mich auch hinunter zum Bahnhof, wo zwei bis drei Mal am Tag die
Dampfzüge hielten.
Interessant
wurde es abends, wenn der Güterzug einlief; da konnte man die Dampflok ganz aus
der Nähe betrachten und hören.
Bei
einer Rangierpause durfte ich manchmal in das Führerhaus zum Lokführer hinaufsteigen;
es war ein rußiger und sicher auch harter Arbeitsplatz.
Meine
heute noch vorhandene Affinität zur „Eisenbahn“ ist sicher durch den
Arbeitsplatz meines Vaters bei dieser Institution bedingt.
Die
anfangs vier vom Sulzfelder Bahnhof zu betreuenden Bahnübergänge wurden damals
natürlich manuell bedient.
Dicht bei ihnen hatte man ein kleines Häuschen
errichtet, in welchem sich die Männer während ihrer Dienstschicht aufhalten
konnten; sie waren telefonisch mit den Bahnhöfen Zaisenhausen, Sulzfeld und
Eppingen verbunden und wurden von ihnen über die Abfahrt eines Zuges über
dieses Medium unterrichtet. In der Regel kurbelten die Männer erst dann die
Schranken herunter, wenn sie den herannahenden Zug gesichtet hatten (sporadisch kam es vor, dass die Männer bei
ihrer eintönigen und langweiligen „Tätigkeit“ einschliefen, und der Zug dann
mit heftigem Gepfeife über den unbeschrankten Bahnübergang brauste; wenn der
Lokführer den Vorgang meldete, bekam der „Schläfer“ eine Verwarnung und eine
Geldstrafe).
Entsprechend
der Art seiner Schicht, musste ich meinem Vater in einer mit einem Tuch
umwickelten Milchkanne sein Essen zu seinem wechselnden Arbeitsplatz bringen;
meistens lief ich auf den Schienenschwellen zu den Bahnwärterhäuschen oder zum
Tunnel hinaus.
Ich
besuche heute immer noch regelmäßig meine Schwester auf der Bäreninsel;
meistens gehe ich zu Fuß die 2 km hinauf, und immer wieder tauchen beim Anblick
der Häuser und Örtlichkeiten natürlich Bilder der Menschen auf, die damals
gelebt und zu denen man in irgendeiner Art und Weise in Beziehung gestanden
war.
Schräg
gegenüber hatte Schuhmacher Fischer seine Werkstatt.
Es
war ein kleiner Mann, der den ganzen Tag auf einem niedrigen Drehstuhl saß und
mit einfachsten Mitteln und Werkzeugen versuchte, die Gehwerkzeuge seiner
Mitmenschen einigermaßen funktionstüchtig zu halten; nach seinem Tod übernahm
sein langjähriger Mitbewohner Karl Hable seine Arbeit.
Im
letzten Haus auf der rechten Seite der Neuen Bahnhofstraße in Richtung Bahnhof
hatte der „Dampfhansl“ einen kleinen Installationsbetrieb, bei dem ihm später
sein Sohn Hans half.
Im
Winter war ich oft Kunde bei ihm, denn er musste die immer wieder aufbrechenden
Löcher an unseren Zinkbettflaschen zulöten.
Der
größte Betrieb war die Schreinerei Friedrich, die später zu einem Möbelhaus
mutierte.
Unserem
Haus gegenüber stand - und steht heute noch - eine imposante Sandsteinvilla, in
der Max Fischer mit der „Lumpenzwick“ seine Familie ernährte, indem er sich von
irgendwoher Berge von Kleidern und sonstigen Textilien besorgte und diese dann
von etwa 15 Frauen sortieren und sortengerecht bündeln ließ; oftmals während
des Tages hörte man sie singen, und durch bei schönem Wetter geöffnete Fenster
kamen auch die Nachbarn in den Genuss
ihrer mehrstimmig vorgetragenen Lieder.
Leider
gab es da aber ein paar Lausbuben, die durch ihre in die offenen Fenster
geworfenen „Wasserbomben“ die Frauen veranlassten, diese wieder zu schließen,
nachdem sie
vorher
ihre Meinung über diese Bande lautstark bekundet hatten.
Den
"Henschel" von Max Fischer fuhr Hermann Fischer.
Er
ging mit mir manchmal zur "Kinomaiere", denn diese kleine, energische
Frau führte anfangs der 50-er im Saal des "Badischen Hofes“ über das
Wochenende den staunenden Sulzfeldern ihre gut besuchten Filmdarbietungen vor
(beim "Förster vom Silberwald" reichte die Schlange bis zur Straße).
Als
mir dann 1954 Peter Pottiez die Eintrittsgebühr von 50 Pfennigen spendierte,
sah ich hier auch meinen ersten Film ("Winchester 73“); vor Aufregung
passierte sogar ein kleines Malheur.
Hermann
Fischer nahm mich auch manchmal auf seinen Fahrten mit; zwei davon sind mir
noch in guter Erinnerung - eine nach Dürkheim in der Pfalz, wo er mir das
"Große Fass" zeigte, und eine zweite nach Gernsbach im
Nordschwarzwald.
Am
östlichen Ende der Luisenstraße kannte ich auch einen Ort, an dem ich mich
gerne aufhielt, denn hier betrieb Josef Weiß zusammen mit seinen Söhnen Rudolf
und Heinz eine kleine Schreinerei (aus ihr ging später die heutige Holzhandlung
„Himmel&Weiß“ hervor); den dem frisch gesägten Holz entströmende Duft
mochte ich.
Gegenüber
dem „Schreiner-Weiß“ hatte Wilhelm Guggolz seine Küferei und produzierte Bütten
sowie große und kleine Fässer für die immer größer werdende Anzahl der
„Wengerter“ in Sulzfeld. Seine Frau hatte eine andere Vorliebe: Sie huldigte
der Muse der Dichtkunst und gilt heute als die Heimatdichterin unseres Dorfes.
Bei
dieser Skizzierung der „Bäreninsel“ möchte ich es belassen, denn die 28 Jahre
auf diesem Flecken böten noch Stoff für viele Seiten.--
 Ein
Teil dieses Bildes zwingt mich geradezu, noch ein nicht unwichtiges Kapitel
meiner „Bäreninsel-Vita“ anzufügen.
Ein
Teil dieses Bildes zwingt mich geradezu, noch ein nicht unwichtiges Kapitel
meiner „Bäreninsel-Vita“ anzufügen.
Es
ist der kleine Hund - unser Karo; 16 Jahre war er unser ständiger Begleiter.
Interessant
ist die Geschichte, wie er zu uns kam.
Es
war im Frühjahr 1953, als ich aus irgendeinem Anlass auf dem „Luisenhof“
zwischen Zaisenhausen und Gochsheim war.
Als
wir ankamen - mein Nachbar Werner war noch dabei - stieg gerade ein Mann in
seinen Laster und fuhr aus der Hofeinfahrt hinaus auf die Straße.
Plötzlich
bemerkten wir, dass er vergessen hatte, die hintere Ladeklappe zu schließen und
sahen auch gleichzeitig, dass sich da etwas bewegte.
Als
er auf die Straße Richtung Gochsheim einbog, fiel etwas herunter. Wir liefen
hin und sahen zwei kleine Hunde, die auf dem Boden verstört herumkrabbelten.
Wir
rannten noch auf die Straße, riefen und winkten dem Laster hinterher, aber der
Fahrer reagierte nicht mehr.
Nach
Rücksprache mit den Luisenhofbauern - er schätzte das Alter der Welpen auf zwei
bis drei Wochen - nahmen Werner und ich die beiden mit nach Hause.
Meine
Mutter stellte Karo - so hatte ich ihn sofort getauft - ein Schälchen Milch
hin, während ich eine Holzkiste mit etwas Stroh und Heu auslegte.
Am
Abend setzte ich Karo hinein und stellte sie in unseren Schopfen. Ich konnte es
am nächsten Morgen kaum erwarten, bis ich nach Karo schauen konnte.
Er
war putzmunter und schlapperte sofort an dem Milchschälchen herum.
Später
erfuhr ich, dass Werners Hündchen am Abend noch gestorben war; möglicherweise
war es durch den Sturz von dem LKW doch verletzt worden.
Karo
wuchs und gedieh und war aus unserer Familie in kurzer Zeit nicht mehr
wegzudenken.
Er
kannte bald auch unsere Gepflogenheiten und die Tagesabläufe und reagierte
bereits im Voraus auf anstehende Vorhaben; wenn wir z.B. unsere Feldschuhe aus
dem Schrank holten, rannte er vor Vorfreude ganz wild durch die Gegend, denn er
wusste jetzt, dass es wieder ins Gelände ging, wo ihn die mannigfaltigsten
Erlebnisse erwarteten.
Er
tauchte auch überraschend überall im Dorf auf und hatte viele Bekanntschaften
unter seinen Artgenossen.
In
den kalten Wintern verließ er ganz selten seinen Lieblingsplatz - den
Kohlenkasten im Herd.
Wir
vermissten ihn sehr, nachdem wir ihn 1969 hatten einschläfern lassen.
-
Augustonkel -
In
manchen Beiträgen dieser „Lebensfragmente“ taucht immer mal wieder der Name
"Augustonkel“ auf.
Wer
war er?
Er
war der Bruder der verstorbenen Ehefrau Sophie meines Stiefvaters Karl Himmel,
wohnte in der Bachstraße und besaß eine kleinere Landwirtschaft; ich denke, sie
umfasste etwa drei Hektar.
Im
Stall standen meist fünf Kühe, die mit ihrer Milch ihn und seine Tochter Wilma
versorgten und daneben als Zugtiere dienten.
Da
wir öfter gezwungen waren, dieses Gespann für unsere Arbeiten auf den Feldern
und im Weinberg auszuleihen, erwartete er selbstverständlich, dass wir als
Gegenleistung ihn bei den im Jahresverlauf anfallenden landwirtschaftlichen
Arbeiten unterstützten; das „Wir“ bezieht sich hier vor allem auf meine Mutter
und mich, im Besonderen auf Erstgenannte.
Bei
welchen Arbeiten mussten/konnten wir helfen?
Wir
unterstützten ihn vor allem bei der Kartoffel-, Rüben- und Weizenernte.
Die
Kartoffeln wurden von ihm und manchmal auch von meinem Vater mit dem Karst aus
dem Boden gebuddelt, und unsere Arbeit bestand dann darin, die Kartoffeln zu
sortieren und in Säcke einzufüllen.
Die
Rüben wurden einzeln mit einem Stecher aus dem Boden gestochen; wir mussten
dann mit einem Messer das Kraut abschneiden, die Knollen von der Erde befreien
und sie dann zu Haufen aufschichten.
Genau
wie die Kartoffeln wurden sie dann am Abend - die Arbeiten dauerten oft viele
Tage - auf das Fuhrwerk geladen, und die Kühe zogen dann die Fracht nach Hause,
wo sie im Keller oder in der Scheune noch verstaut werden mussten.
Während
die Arbeiten auf den Kartoffel-und Rübenäckern teilweise durch Regen und Kälte erschwert wurden, war es bei der Weizenernte
oft brütend heiß.
Vor
dem Jahr 1950 wurde der Weizen - ebenso wie Gerste und Roggen - noch mühsam mit Reff und Sichel geerntet.
Später
schaffte sich Augustonkel eine Mähmaschine an, die von seinen Kühen gezogen
wurden und welche die Arbeit wesentlich erleichterte und beschleunigte.
Die
gebündelten Weizengarben wurden auf den Leiterwagen gegabelt und anschließend -
oft auf waghalsigen Fuhren durch die ausgewaschenen Furchen der Feldwege - zu
seinem Haus in der Bachstraße transportiert, wo sie dann wiederum einzeln in
der Scheune auf die Tenne verfrachtet wurden.
Im
späten Herbst wurde dann eines Tages die mobile Dreschmaschine in die Scheune
bugsiert - mit einem oft unwilligen Pferdegespann gar nicht so einfach - und
die Ähren wurden in der Maschine von ihrer Frucht befreit.
Das
Stroh wurde später in der Scheune verstaut; es wurde im Winter zusammen mit dem
geernteten Heu und den kleingeschnittenen Rüben an die Tiere verfüttert.
Den
Weizen holte ein Müller ab.
Der
Eigenbedarf an Mehl wurde später ins Haus geliefert, der Rest wurde verkauft.
Ich
denke, es wäre vergeblich, jemandem, der diese Zeit nicht miterlebt hat, auch
nur in kleinen Dimensionen klar zu machen, unter welchen Umständen die
geschilderten Arbeiten oftmals erledigt werden mussten.
Als
extrem erlebten wir kalte Regentage bei der Rüben-und Kartoffelernte, bei denen
sich die nassen und klammen Finger oft wie abgestorben anfühlten und gewollte
Arbeitsabläufe verweigerten oder völlig blockierten.
Das
krasse Gegenteil waren glühende Sommertage, an denen wir das schnittreife
Getreide ernten mussten.
Enorm
unangenehm - um nicht zu sagen: ekelhaft - empfand ich die Gerstenernte, denn
die sich lösenden Grannen hafteten überall auf dem schweißnassen Körper; das
Beißen und Stupfen war kaum auszuhalten.
Manchmal
stahl ich mich davon, fuhr mit meinem "Tripad“ zum „Badhäusle“ und sprang
in das kühle Nass, aus dem ich wie neugeboren wieder herauskam.
Als
mein Vater 1970 altersbedingt die Kleinlandwirtschaft aufgab, kam ich nur noch
selten in die Bachstraße.
August
starb mit 73 an den späten Folgen eines Unfalls.
- Kleinbauern -
Wie
bereits an anderer Stelle erwähnt, war die finanzielle Situation bei uns
permanent angespannt. Mein Vater verdiente – trotz seiner harten Arbeit –
einfach zu wenig.
Deshalb
gab es keinen Ausweg: wir mussten nach Alternativen suchen.
Die
77 ar Boden, die mein Vater geerbt hatte, mussten uns helfen. Sie mussten unser
Überleben sichern.
Sie
taten es dann auch, aber unter welchen Bedingungen.
In
dem kleinen Anbau – unserem „Schopfen“ - hielten wir Hühner, Ziegen, Schweine,
manchmal auch Hasen und Gänse.
Sie
trugen wesentlich zur Entspannung unserer finanziellen Situation bei und
erlaubten die Erfüllung manchen–oft notwendigen- Sonderwunsches, verursachten
aber jeden Tag eine Menge Arbeit.
Daneben
bewirtschafteten wir drei größere Äcker (je ca. 20 ar).
Sie
wurden abwechselnd mit Weizen und Kartoffeln bepflanzt.
Alle
diese Arbeiten bedurften äußerst mühseliger Handarbeit.
Zur
Vorbereitung der Kartoffelbepflanzung mussten im Frühjahr mit der Harke
Hunderte von Löchern gegraben werden, in die dann je eine Kartoffel gelegt
wurde.
Anschließend
wurden die Löcher wieder eingeebnet.
Im
Laufe des Jahres musste mehrmals das Unkraut gejätet, in manchen Jahren die
Kartoffelkäfer abgesammelt werden.
Im
Herbst wurde dann jeder Busch mit dem Karst herausgehauen, und die Kartoffeln
von den Kräutern befreit.
Die
Frauen und Kinder sammelten sie dann in Körbe, die dann in Säcke entleert
wurden.
Am
späten Nachmittag schickte mich mein Vater dann ins Dorf, um beim „Augustonkel“
die Kühe aus dem Stall zu holen, sie vor den Leiterwagen zu spannen und damit
hinauf zum Rietacker zu fahren.
Er
wuchtete dann die Säcke auf den Wagen, und wir fuhren dann zum „Maiers Franz“,
wo der größte Teil der Ladung abgeliefert wurde. Drei bis fünf Mark bekamen wir
für den Zentner.
Noch
mühseliger war die Weizenernte.
Nachdem
der Acker im Frühjahr umgepflügt und mit der Egge eingeebnet war (mit Hilfe von
"Augustonkels" Kuhgespann), erfolgte dann die Einsaat, anfangs per
Hand, später dann mit der Maschine.
Als
der Weizen dann im August schnittreif war, machte sich unsere Familie früh am
vereinbarten Tag auf zum Acker.
Mein
Vater schnitt mit dem „Reff“ die Mahden, meine Mutter bündelte mit der Sichel
die Ähren und legte sie in die von den Mädchen ausgelegten Stricke.
Meine
Aufgabe war es, die Ähren zu schnüren und die Garben in Haufen zusammen zu stellen.
Gegen
Abend waren die 20 ar Weizen geschnitten.
Nebenbei:
Heute verrichtet ein Mähdrescher diese Arbeit in 15 Minuten, und dann ist die
Frucht schon „im Sack“.
Wenn
kein Regen kam, wurden die Garben nach zwei bis drei Tagen eingesammelt und mit
dem Leiterwagen und „Onkel Gustavs“ Kuhgespann zur Familie Fundis in der Neuen
Bahnhofstraße gefahren; einen Teil ihrer Scheune hatten wir gemietet.
Dort
musste der hochbeladene Leiterwagen rückwärts in den Hof und dann in die
Scheune bugsiert werden.
Einzeln
wurden die Garben dann mit einem Seilzug zur Tenne hinaufbefördert.
Ich
befand mich auf dem Wagen und schob den Seilhaken zwischen die Garben und
die Schnüre ("Strickla"). Es war eine mühselige und staubige
Arbeit.
Und
damit war es noch lange nicht getan.
Nach
einer gewissen Trocknungsphase musste die gesamte Prozedur wiederholt werden -
allerdings in anderer Richtung - und mit dem vollbeladenen Wagen ging es dann
hinunter zur "Dreschhalle" in der Nähe des Sportplatzes.
Christian
Bauer war dort der Boss, der alles regelte und lenkte.
Wenn
man oft nach Stunden dann an der Reihe war, wurde der mit den Weizengarben hoch
beladene Wagen neben die Dreschmaschine gefahren, und mein Vater gabelte dann
die Bündel auf die Maschine, wo sie meine Mutter in Empfang nahm.
Sie
löste die Stricke und schob die Garben in den Auffangschlund der Maschine; die
Stricke warf sie herunter.
Meine
Aufgabe war es, die am hinteren Teil der Dreschmaschine herausgepressten
Strohballen wegzunehmen und sie seitlich zu stapeln; sie wurden später
abgeholt.
Der
seitlich aus der Dreschmaschine herausquellende Weizen wurde in bis zu zwei
Zentner schweren Maltersäcken gesammelt und auf den Leiterwagen verfrachtet.
Nach
der Bezahlung beim Dreschmeister fuhren wir mit ihnen nach Hause, wo meinen
Vater die härteste Arbeit erwartete.
Er
musste die oft 100 Kilo schweren Säcke auf den Speicher hinauftragen und sie
dort auf dem Boden zum Trocknen ausleeren.
Er
ließ sich wie immer nie etwas anmerken, aber ich bin mir heute sicher, dass er
oft am Ende seiner Kräfte war.
Meine
Aufgabe war es dann, die nächsten Tage den Weizen mit dem Rechen umzuwälzen –
und dies täglich mehrere Male.
Wenn
die Körner nach etwa zwei Wochen ihre Feuchtigkeit verloren hatten, wurden sie
wieder in die Säcke gefüllt, hinuntergetragen und mit dem Leiterwagen zu einem
Müller gefahren, meistens nach Mühlbach.
Tage
später konnten wir dann das Mehl abholen.
Oft
waren es keine 10 Zentner, die von der mühseligen und harten Arbeit für uns
übrigblieben.
Aber
das Leben ließ keine andere Wahl.
Unser „Wengert“
– Wie er entstand –
Es
muss zwei oder drei Jahre nach Kriegsende gewesen sein, als wir im „Unteren
Berg“ ein etwa 10 ar großes Grundstück besaßen.
Wie
alle Grundstücke in diesem Gewann, lag auch unseres mit seiner oberen Hälfte am
steilsten Teil, für die intensive Sonneneinstrahlung ideal, folglich zum
Weinanbau genau richtig.
Wie
mein Vater zu diesem verwilderten Wiesenstück mit zwei Obstbäumen in der Mitte
gekommen ist, weiß ich nicht mehr.
Auf
jeden Fall war klar, dass er darauf einen Weinberg anlegen wollte.
Tagelang
mühten wir uns, die Fläche von Dornensträuchern und anderem Wildwuchs zu
befreien.
Im
darauffolgenden Frühjahr war es dann soweit:
Das
„Neigreit“ konnte angelegt werden.
Da
diese harte Arbeit von einem einzelnen Menschen nicht bewerkstelligt werden
konnte – ich wäre mit meinen neun oder zehn Jahren überhaupt keine Hilfe
gewesen – schaute sich Karl nach Hilfe um und fand sie im „Athlet“. Dies war
der treffende Spitzname unseres Nachbarn Kolb.
Ich
weiß nicht mehr, wie viele Tage sie im „Unteren Berg“ verbrachten; ich weiß nur
noch, wie sie abends erschöpft und halb erfroren am Tisch in unserer Küche
saßen, und wir feststellen mussten, dass der "Athlet“ nicht nur bei der
Schwerstarbeit im "Unteren Berg" seinen Mann stand, sondern auch
darin einsame Spitze war, wenn es galt, die Vorräte unserer Räucherkammer doch
beträchtlich zu reduzieren. Er hatte es sich aber allemal redlich verdient.
Was
genau taten die beiden?
Während
heute beim Anlegen eines neuen Weinberges modernste GPS-Technik zum Einsatz
kommt, ging es im „Unteren Berg“ primitiver zu; das Ergebnis konnte sich aber
trotzdem sehen lassen.
Mit
langen Schnüren, einem Meterstab und kleinen, etwa 30 cm langen Holzlatten,
wurden zunächst die Stellen markiert, wo später die Löcher für die Rebstöcke
gegraben werden mussten.
Dabei
mussten sie genau darauf achten, dass die Stöcke exakt „in der Flucht“ stehen
und die sechs Reihen auch präzise parallel den Hang hinauf verlaufen würden.
Diese
Arbeit nahm einige Tage in Anspruch, war aber weniger anstrengend.
Was
dann kam, war härteste Knochenarbeit.
Mit
Spaten und Pickel mussten die vielen, etwa 50 bis 60 cm tiefen Löcher aus dem
zähen und harten, teilweise noch gefrorenen Boden praktisch „herausgepökelt“
werden.
Viele
Tage dauerte diese alle Kräfte beanspruchende Plackerei.
Im
Frühjahr wurden dann die Rebstöcke und die Weinbergpfähle gekauft und mit Hilfe
von Gustavs Kuhgespann an den Fuß des Hangs geschafft.
Die
Pfähle wurden seitlich in die Löcher gerammt, die Rebstöcke hineingestellt und
mit Erde überdeckt; wenn kein Regen zu erwarten war, mussten sie jeden zweiten
Tag gewässert werden.
Die
monatelange Arbeit war jetzt endlich zu Ende, der „Wengert“ war fertig.
Die
Rebstöcke standen in Reih und Glied und zeigten bald die ersten Triebe.
Kein
Mensch im Dorf fand die Arbeit dieser 2 Männer besonders erwähnenswert, aber
für mich ist sie heute noch ein Sinnbild von Durchsetzungsfähigkeit, Zähigkeit
und eisernem Willen.
Zwei
bis drei Jahren mussten wir noch warten, bis die ersten Trauben herangereift
waren.
Als
der Wengert später voll „im Betrieb“ war, erbrachte die Lese – sie war immer
ein festliches Erlebnis - im Herbst etwa 1000 Liter Wein, und wir taten das
Jahr über alles, dass im nächsten Herbst die Fässer zur Aufnahme für die neue
Ernte wieder bereit waren.
Nur
ein paar Wochen im Winter beansprucht ein Weinberg seine Besitzer nicht.
Schon
im Februar beginnt der Jahresreigen der Arbeiten rund um die Reben.
Sie
müssen zurückgeschnitten und dann wieder an die Drähte angebunden werden.
Nach
den ersten Regenfällen wurde damals der Boden mit dem Karst tief umgeharkt, im
Jahresverlauf wurde er dann mehrmals mit der Harke aufgelockert.
Eine
wichtige Arbeit war das Spritzen gegen Schädlinge und vor allem Peronospora.
In
den ersten Jahren war dies ein sehr mühsames Geschäft, denn das dafür
notwendige Wasser mussten wir von zuhause mit Eimern und Bottichen mit dem
Ziehwagen die 2 km zum "Unteren Berg“ hinauf transportieren; die Verluste
unterwegs waren enorm. Erst an Ort und Stelle wurden dann die Chemikalien unter
heftigem Rühren mit dem Wasser vermischt.
Mit
dem manuell zu bedienenden „Spritzbutten“ stapfte mein Vater durch die Reihen
und sprühte die Giftbrühe auf die Blätter.
Ich
musste ihm in zwei Eimern die Brühe zum Nachfüllen hinterhertragen.
Pech
für mich war es immer, wenn der „Spritzbutten“ oben auf dem Berg leer geworden
war, denn dann hieß es, die nahezu 20 Kilogramm Spritzbrühe den steilen Hang
nach oben zu schleppen.
- Wengerthäuschen -
Ein
paar Jahre später wurde es leichter für uns.
Auf
dem Küchentisch entwarf er den Plan eines „Wengerthäuschens“.
Akribisch
zeichnete er die Seitenwände, das Dach und vergaß auch nicht, an der späteren
Südseite die Türe einzupassen.
Wichtig
waren auch die zwei Dachtraufen, um das Regenwasser einzusammeln, denn dies
ersparte uns die Mühen, die mit dem Wassertransport verbunden gewesen waren.
Immer
wieder verließ er die Küche und überprüfte auf dem Hof seine fiktiven Maße auf
ihre spätere Brauchbarkeit.
Als
er mit seiner Arbeit fertig und zufrieden war, ging er zum „Schreinerweiß“
rüber, bestellte die notwendigen Bretter und ließ sie sich vor dem Abholen
gleich zuschneiden.
Im
Hof wurde das Häuschen dann komplett aufgebaut; auch das Dach und die Traufen
wurden angebracht.
Für
die vier Eckpfosten goss er sich mit Hilfe von vier alten Eimern die
Betonklötze, die sie später aufnehmen sollten.
Bevor
er sein Wunderwerk wieder in seine Einzelteile zerlegte, nummerierte und
kennzeichnete er sie mit Zahlen und schwarzen Farbmarkierungen.
Eines
Tages machte ich mich früh morgens zu meinem bekannten und gewohnten Gang zum
„Augustonkel“, holte das Kuhgespann aus dem Stall, spannte es vor den Wagen und
trabte mit ihm durch das Dorf zum Haus in der Neuen Bahnhofstraße mit der
Nummer 7.
Als
das Häuschen auf dem Wagen verstaut war, machten wir uns auf den Weg zum
"Unteren Berg“.
Sinnvoll
und ökonomisch wäre es gewesen, die Hütte in der geografischen Mitte des
Weinbergs aufzustellen, denn dies hätte die Laufwege beim Spritzen halbiert.
Warum
er es aber ganz oben aufbaute, weiß ich nicht. Möglicherweise wäre es ihm zu
mühsam gewesen, alles in die Mitte hinauf- bzw. hinunterzuschaffen.
So
mühten sich die zwei Kühe mit ihrer Last den „Viehtriebweg“ hinauf, sodass wir
ganz oben die Teile abladen konnten.
Gegen
Mittag thronte sein Werk in luftigen Höhe.
Nahtlos hatte alles
gepasst. Die zwei Dachtraufen endeten innen und sollten kommendes Regenwasser
in zwei beim "Burgahn“ erstandene Plastikfässer leiten.
Eine
weitere Erleichterung sollte später der Kauf einer benzinbetriebenen Spritze
bringen; durch sie wurden meine Laufwege stark eingeschränkt, und sie brachte
so eine große Erleichterung.
- Vom „Wengert“
auf den Tisch -
Wie
bereits kurz erwähnt, war der Höhepunkt im Jahresreigen eines „Wengerters“ die
Traubenernte, die Lese.
Bereits
Wochen vorher wurden die Bütten und die Fässer überprüft und gereinigt, wobei
vor allem die Säuberung der Fässer eine recht mühsame und aufwändige Arbeit
war.
Wir
hatten vier Fässer mit insgesamt 1000 Liter Fassungsvermögen.
Sie
mussten zunächst einzeln den schmalen und relativ steilen Kellergang
heraufgeschafft werden, bevor dann mit einem Spezialhammer die oberen drei
Eisenreifen entfernt werden konnten.
Nachdem
dann das Fass von restlicher Flüssigkeit und gröberen Weinsteinbrocken befreit
worden war, musste ich meiner Rolle als „Fasskriecher“ gerecht werden. Ich
kroch also in das Fass und schrubbte mit einer harten Bürste den Boden und die
Innenwände sauber.
Anschließend
platzierte mein Vater getrocknete Schilfbahnen zwischen die einzelnen Bretter
(„Dauben“), stülpte nacheinander die einzelnen Eisenbänder wieder drüber und
hieb sie mit kräftigen Schlägen mit dem Spezialhammer (er hatte längs eine
schmale Kerbe) fest.
Zum
Schluss wurde wiederum der Deckel eingepasst; auch hierbei durfte das Schilf
nicht vergessen werden.
Beendet
wurde die Arbeit an den Fässern, indem 30 bis 40 cm lange „Schwefelschlutten“
angezündet und in sie hineingehängt wurden; ich vermute, sie sollten die Fässer
desinfizieren.
Als
der große Tag dann gekommen war, wurde die große Bütte, der Tragebutten, Eimer,
Messer und Scheren sowie allerhand Kleinkram auf den Leiterwagen des
Kuhgespanns verladen und hinunter ging`s dann zum „Unteren Berg“.
Vor
allem bei schönem Wetter herrschte bereits morgens eine aufgeheiterte, lustige
und fröhliche Stimmung.
Die
Schnitterinnen und Schnitter wurden dann auf die einzelnen Reihen verteilt; die
abgeschnittenen Trauben warfen sie in ihre mitgeführten Eimer und die wiederum
kippten sie, wenn sie voll waren, in den Tragebutten, den mein Vater dann bei
Bedarf in die große Bütte auf dem Leiterwagen ausschüttete.
Bei
jedem Butten, den er ablud, schnitzte er eine Kerbe in seinen mitgeführten
Stock; so ließen sich die Erträge der einzelnen Jahre gut vergleichen.
Um
die Mittagszeit sammelte ich Holz und entfachte ein kleines Feuer, auf dem dann
die Fleischwürste heiß gemacht wurden, so dass sich wenig später alle im Kreis
darum versammelten und sich ihr einfaches Mahl schmecken ließen.
Am
frühen Nachmittag war alles beendet, und wir machten uns auf den Heimweg,
allerdings nicht, bevor ich zuvor noch ein kleines Bündel Akazienäste sammeln
musste, das später in der großen Bütte Verwendung finden sollte.
Zuhause
wurde das Fuhrwerk in den hinteren Hof bugsiert, wo bereits die große Bütte mit
der Raspel vorbereitet war.
Mein
Vater schüttete dann den Inhalt der Bütte auf dem Fuhrwerk Eimer für Eimer in
die Raspel, deren Kurbel wir bedienen mussten, was nicht einfach war.
Gegen
Abend hatte sich all die schöne Traubenpracht in eine glitschige Masse aus
Traubenkämmen und süßem Saft verwandelt; meistens war die Bütte randvoll (1000
Liter).
Bei
warmem Wetter begann der Gärvorgang sofort und dauerte dann etwa ein bis zwei
Wochen; die Maische musste ich jeden Tag einige Male mit einer Harke umwälzen.
Die
Bütte stand etwas erhöht auf vier Holzbohlen, so dass man nach etwa zwei Wochen
den Spunten entfernen und den herausströmenden Wein in Eimern auffangen konnte;
er wurde in den Keller hinuntergetragen und über den aufgesetzten Holztrichter
in die jeweiligen Fässer geschüttet.
Dort
vergor er vollends, bis dann im Frühjahr wieder eine harte Arbeit auf
Erledigung wartete: Der Wein musste abgelassen, die Fässer aus dem Keller
geholt und gereinigt werden, bevor dann der Wein wiederum in sie abgefüllt
werden konnte.
Neben den 1000 Liter Wein, die wir pro Jahr
produzierten und verbrauchten, mussten wir ja auch noch unsere zahlreichen
Äpfel- und Birnenbäume abgeerntet werden.
Sie lieferten ebenfalls etwa 1000 Liter Flüssigkeit,
in diesem Fall eben Most.
Das Obst brachten wir nach Schütteln, Zusammenlesen
und Einbringen in Säcke zu einem der drei Nachbarn, die die entsprechenden
Geräte zur Verarbeitung besaßen und gegen ein geringes Entgelt zur Verfügung
stellten.
Meistens mahlten und pressten wir beim Eigenmann,
vier Häuser südlich von uns.
Im Gegensatz zur Obstmühle, die elektrisch
angetrieben wurde, musste die Saftpresse manuell bedient
werden.
Sie wurde in mehreren Lagen mit dem Mahlbrei befüllt
und dann an einem langen Hebel bedient.
Der herausgepresste Saft wurde in einem Bottich
aufgefangen.
Aus ihm schöpfte ich dann den Saft eimerweise in ein
ca. 50-Literfässchen, das im Ziehwagen lag.
Wenn es gefüllt war, zog ich die Fuhre nach Hause
und trug den Süßmost wiederum eimerweise in den Keller, wo die Fässer bereits
darauf warteten, mit ihm befüllt zu werden.
Beim
Lesen des Vorangegangenen kann schon ein leichter Verdacht entstehen, dass es
sich bei den damalig Handelnden doch um mehr oder minder schwere Fälle von
Alkoholiker handeln könnte; eine Familie mit zwei Erwachsenen und vier
minderjährigen Kindern verputzt jährlich 1000 Liter Wein und 1000 Liter Most.
Das
ist doch schon allerhand.
Dieses
Ansinnen bedarf strikten und vehementen Widerspruchs.
Warum?
Die
Menschen damals haben beträchtlich Alkoholmengen zu sich genommen, aber sie
haben auch körperlich hart gearbeitet; heute findet sich in vielen Fällen nur
das Erste.
Dann
gab es damals neben Wein und Most nur noch Wasser als Durstlöscher, und bei den
Arbeiten auf den Feldern und im Weinberg waren oft viele Menschen beteiligt;
vielfach wurden Wein und Most mit glasklarem Wasser, das man den überall
sprudelnden Quellen entnahm, vermischt, so dass es von jedem genossen werden
konnte; manche Flasche Wein wurde auch verschenkt.
Erst
in den frühen 60-er Jahren tauchten Bier, Mineralwasser und weitere Getränke
auf.
Das
Bier der Weigert-Bräu, das es schon bald nach Kriegsende gab, konnten wir uns
allerdings anfangs nicht leisten.
- Winter
–
Dieser
Begriff hat für uns heute seine eigentliche Bedeutung verloren; die letzten
Jahre haben wir hier nahezu all dies nicht mehr erlebt, was sein Wesen und
seine vielfältigen Erscheinungsformen ausmachen.
Die
Winter in den Kriegsjahren und bis 1950 müssen teilweise sehr schlimm gewesen
sein; ich erinnere mich noch gut an die extremen Winter 1944/45 und 1947/48,
vor allem an letzteren.
Warum
litten wir alle unter der Kälte?
Da
war zum einen der Zustand der Häuser, und zum anderen lag es an unserer
Kleidung.
In
der Regel war der einzige beheizbarme Raum die Küche, wo ein Herd sowohl die
Koch- und auch gleichzeitig die Heizfunktion übernehmen musste.
Er
durfte bis spät abends nie ausgehen.
Gefüttert
wurde er mit Holz und Kohlen; zwischenzeitlich wurde das Feuer mit Briketts am
Leben erhalten.
Das
Holz lieferten uns alte Bäume, manchmal wurde auch ein oder mehrere Ster dazu
gekauft.
Später
erschien dann der "Holzsäger" mit seiner Maschine und
zersägte alles in handliche Zylinder; das anschließende Weiterverarbeiten
mit Axt und Beil in ofenfertige Holzscheite oblag dann mir.
Mit
Hilfe einer von Vater gebastelten Zugvorrichtung hievten wir anschließend den
gesamten Stapel an der Hauswand hoch in den Speicher.
Die
im Frühjahr beim Rebschnitt angefallenen Reben hatten wir gebündelt nach Hause
transportiert und auf dem Schopfen verstaut. Sie wurden zum Anzünden
verwendet.
Die
Kohlen mussten wir vor dem Winter in der Nähe der Güterhalle abholen.
Der
„Kohlen-Mayer“ schippte sie aus dem Eisenbahnwaggon, und wir mussten sie in die
bereitgestellte Waage verladen.
Wenn
der Zeiger die Zentnermarke (50 kg) erreicht hatte, musste ich den Kohlensack
an die Öffnung halten, und mein Vater kippte die schwarze und staubige Pracht
hinein.
Drei
Säcke konnten wir auf unserem Handwagen verstauen, dann keuchten wir mit der
Kohlenfracht den „Bahnhofsbuckel“ hinauf und trugen unsere Schätze in den
Keller. Etwa 10 Zentner pro Winter bekamen die „Eisenbähnler“ von ihrem
Arbeitgeber zu etwas reduziertem Preis.
Die
anderen Räume in unserem Haus konnten nicht beheizt werden; jeden Morgen waren
so alle Fenster mit dicken Eisblumen bedeckt.
Es
waren phantastische Kunstwerke, auf die wir aber gerne verzichtet hätten.
Brutal
wurde es natürlich abends, wenn wir in unser Schlafzimmer gehen mussten. Mutter
half uns manchmal, indem sie Backsteine im Backofen des Herdes aufwärmte, sie
dann mit Tüchern umwickelte und uns mit ins Bett gab.
Da
die Häuser nicht isoliert waren, froren manchmal die Wasserleitungen ein, und
wenn sie unsachgemäß aufgetaut wurden, platzten sie oft. Dann half nur noch
eines: Runter in den Keller und den Zentralhahn zudrehen. Für eine Weile gab es
dann eben im ganzen Haus kein Wasser mehr.
Da
es auch noch keine Kanalisation gab, floss alles Wasser aus der Küche, aus den
Dachrinnen, aus sonstigen Räumen und den Ställen am Hausrand entlang hinaus in
die Straßenrinne.
Mit
Beil und Axt mussten die dick mit Eis überzogenen Gehwegplatten morgens oft
frei gehackt werden.
In
manchen Jahren lähmten auch Unmassen von Schnee das Dorf und blockierten nahezu
jedes Fortkommen, so dass tagsüber ein von vier Pferden gezogener Schneepflug
die Dorfstraßen einigermaßen freihielt. Die wenigen Autos, die es nach dem
Kriegsende im Dorf gab, hatten lange Zeit ihre Ruhe.
Ich
kann mich noch gut erinnern, wie an manchen Morgen mein Vater mit Schippe und
Besen einen schmalen Pfad zum Stall hinüber freischaufeln musste, um Hühner und
Schweine füttern zu können.
Damit
wir Kinder überhaupt zur Schule rübergehen konnten, mussten uns die Männer
vorher auf der Straßenmitte ebensolche Gassen schaffen.
Einen
Nebeneffekt der damals noch nicht vorhandenen Kanalisation nutzten wir Buben
weidlich aus, denn die im ganzen Dorf dick mit Eis bedeckten
"Straßenrinnen“ waren ideale Schlittschuhbahnen; überall im Dorf sausten
wir auf ihnen herum.
Ebenso
tummelten wir uns mit unseren „Absatzreißern“ auf den dicken Eisflächen der
"Bombentrichter“, einem Überbleibsel der Angriffe der amerikanischen
Flugzeuge auf Munitionszüge.
In
jeder freien Minute bewegten wir auch unsere Schlitten, einzeln und manchmal im
Pulk.
Der
„Bahnhofsbuckel“ war sehr beliebt, weil nahe; gefahren wurde aber auch am
"Duchbuckel“ am östlichen Ende der Friedrichstraße.
Außerhalb
des Dorfes trieben wir unsere Schlitten über die Hänge am „Unteren Berg“, dem
„Rietbuckel“ und vor allem über die verschiedenen Abfahrtsmöglichen, welche die
Ravensburg bot.
Das
„Steile Dach“ in der Nähe des Schießstandes blieb den Könnern vorbehalten.
Um
1952 muss es gewesen sein, als wir uns aus Fassdauben zum ersten Mal primitive
Skier zusammenbastelten und mit Hilfe von Weinbergpfählen als Skistöcken die
Hänge hinunterrutschten.
Als
das für uns tollste „Nebenprodukt“ der strengen Winter empfanden wir die immer
wieder verordneten "Kohlenferien“; sie genossen wir stundenlang im Schnee
und auf dem Eis.
Bei
vielen fehlte es allerdings auch an schützender Kleidung und vor allem an
brauchbaren Schuhen.
Zu
kaufen gab es nicht viel bzw. man konnte es sich nicht leisten, warme
Wintersachen anzuschaffen (einer Nachbarsfamilie mit sechs Kindern standen nur
zwei Paar Schuhe zur Verfügung).
Stricksachen
mussten als Ersatz herhalten; sie genügten auch in der Regel, aber eines dieser
Utensilien hasste ich wie die Pest.
Da
unsere langen Hosen zu dünn waren, mussten wir darunter gestrickte Strümpfe
anziehen. Noch heute überspült mich ein Grausen, wenn ich nur daran denke, wie
ich morgens kurz vor sechs Uhr - der Zug nach Eppingen fuhr um 6.30 Uhr ab -
auf der Eckbank saß und diese Strümpfe millimeterweise hochzog, wieder nach
unten stieß und doch irgendwann weitermachen musste.
Befestigt
wurden sie dann am Oberschenkel mit Gummibändern, die man normalerweise bei den
Einmachgläsern verwendete; den Mädchen half eine Art von Strapsen.
Wenn
es wieder richtig kalt geworden war, teilten Arbeiter auf den Wiesen neben dem
Kohlbach Richtung Zaisenhausen mit etwa 50 cm hohen Brettern eine 20x20 m große
Flächen ab, die sie mit dem Wasser des umgeleiteten Kohlbaches auffüllten.
Nach
einigen Tagen wurde das entstandene Eis mit Stichsägen herausgeschnitten und in
etwa 20x20x100 cm großen Quadern auf mit Stroh ausgelegten Bauernwagen
abtransportiert.
Der
größte Teil davon wurde in die relativ kalten Keller bei Herrn Rückel in die
Weigert-Brauerei verfrachtet und kühlte dort bis in den späten Sommer seinen
Gerstensaft.
Wenn
er etwas davon entbehren konnte, holten sich auch manche Kaufleute ab und zu
einen Eisbarren; unsere Nachbarin, Frau Kunzmann - sie betrieb einen kleinen
Kolonialwarenladen - schickte mich manchmal mit unserem Leiterwagen zum Rückel
runter, um einen der Barren zu holen. Sie zerstückelte ihn dann und schüttete
die Eisbrocken in eine Metallwanne, in der sie verderbliche Waren aufbewahrte.
So
hart es damals war, den langen und anstrengenden Wintern ihre Freuden
abzutrotzen, umso so intensiver haften diese Erlebnisse bis heute; und heute,
wo wir sie genussvoller gestalten könnten, gibt es sie nicht mehr.
Paradoxe
Welt!
-
Kirschen –
Da
meine Mutter aus dem benachbarten Ochsenburg stammte, hatte sie nach dem Tod
ihrer Eltern drei Äcker geerbt.
Sie
wurden an Bauern im Dorf verpachtet.
Zwei
davon wurden als Fruchtäcker bewirtschaftet; eines der Grundstücke war ein
Wiesenstück mit einem großen Kirschenbaum.
Es
lag unweit des Bauernhofes Schickner, einer heute renommierten Besenwirtschaft.
Jedes
Jahr im Herbst machte ich mich auf nach Ochsenburg und holte die fällige Pacht
ab.
Da
im Württembergischen die obligatorische Unfallversicherung vom
Grundstücksbesitzer bezahlt wurde – im Gegensatz zum Badischen, wo sie der
Pächter entrichten musste – deckten irgendwann die Pachteinnahmen nicht mehr
die Versicherungsgebühren, sodass wir uns 1996 entschlossen, die knapp 80 ar zu
verkaufen, was sich kurze Zeit danach als schwerer Fehler erweisen sollte, denn
ab Anfang 1997 mussten auch bei den Schwaben die Pächter die
Unfallversicherungsgebühren übernehmen.
Diese
Gebührenpraxen sollen hier aber nur am Rande angeführt werden.
Im
Mittelpunkt des Nachfolgenden soll der bereits oben erwähnte Kirschenbaum
stehen.
Dieser
mächtige Baum war jedes Jahr einmal das Ziel einer Gruppe von Sulzfeldern, die
sich an einem schönen Tag im Juni früh morgens mit drei vollgepackten
Leiterwagen durch den Ochsenburger Wald hinauf aufmachte, den reichen Segen
dieses Baumes einzuholen.
Als
dann die Himmels und Belschners nach knapp zwei Stunden im Schwäbischen
angekommen waren, lieh man sich zunächst bei Schickners zwei große Leitern,
denn ohne sie war an den Kirschenschatz nicht ranzukommen.
Dann
wurde gepflückt, was das Zeug hielt.
Frauen
und Kinder kümmerten sich um die unteren Äste, meinem Vater, Christian
Belschner, seinem Sohn Volker und mir war es vorbehalten, die höheren Teile des
Baumes von seinem reichen Schatz zu befreien.
Während
die beiden Männer die Leitern benutzen durften, mussten Volker und ich uns
durch das Geäst des Baumes hangeln; wenn unsere kleinen Körbe voll waren,
ließen wir sie zum Ausleeren an Stricken hinunter.
Es
herrschte ein lustiges und fröhliches Treiben auf und rund um den Baum.
Zur
Mittagsstunde wurde das mitgebrachte Essen ausgepackt, verzehrt und
anschließend wurde weitergepflückt, bis dann am späten Nachmittag die
Weidenkörbe in den Leiterwagen nichts mehr fassen konnten. Auch alle anderen
Körbe und Eimer waren gefüllt und irgendwo auf und rund um die Wagen angebracht
worden.
Alle
waren mehr oder minder erschöpft oder müde, aber der 5 km lange Heimweg durch
den Ochsenburger Wald musste noch bewältigt werden.
Unterwegs
wurde es immer ruhiger, im Wald war es oft bereits dunkel.
Manchmal
hatten wir Kinder Glück, wenn Vater irgendwo auf den Leiterwagen noch eine
winzige Möglichkeit entdeckt hatte, uns abwärts durch den Wald auf dieses freie
Plätzchen zu verfrachten.
Immer wieder – mit Fahrrad oder Auto
– bin ich auf dieser Strecke unterwegs, und obwohl diese Erlebnisse bereits
weit über 65 Jahre zurückliegen, empfinde ich jedes Mal beim Eintauchen in den
oberen Waldeingang diese seltsame Atmosphäre, die damals immer zu spüren war.
Nach
der Ankunft in Sulzfeld wurden die Körbe ausgeladen und die Kirschenernte
gerecht verteilt.
Am
nächsten Morgen machten sich die Frauen daran, die Kirschen zu verarbeiten; der
Großteil wurde in Einmachgläsern eingedünstet, ein kleinerer Teil wurde zu
Marmelade verarbeitet. Als allererstes gab es aber einen Kirschkuchen.
Um
das Jahr 1960 wurde dann alles anders.
Meine
Schwester Elke hatte geheiratet, ihr Mann Herbert hatte einen kleinen
Borgward-LKW, und ich hatte den Führerschein.
Diese
Konstellation erleichterte die jährlichen Ausflüge nach Ochsenburg, beendete
aber auch eine schöne Phase unseres Lebens; eine unvergessliche
„Kirschenromantik“ war ein für alle Mal zu Ende.
- Konfirmation
-
Seit
September 1953 traf sich mein Jahrgang zweimal in der Woche im Gemeindesaal zum
Konfirmandenunterricht.
Pfarrer
Schwarz tat alles, um die etwa achtzig Aspiranten auf die im nächsten April
vorgesehene Konfirmation vorzubereiten; eine Unmenge an Liedversen,
Katechismussprüchen, Psalmen und Bibelteile mussten von uns auswendig gelernt
werden. Eine Woche vor der „Aufnahme in die Gemeinschaft der Gläubigen“
begannen überall in den Familien die Vorbereitungen für das Fest nach dem Akt
in der Kirche; im Gegensatz zu heute, feierte man meistens zuhause.
Am
Mittwoch ging es mir noch gut, am Donnerstagmorgen bekam ich aber heftiges
Nasenbluten, das während des Tages und in der Nacht auf Freitag nicht zu
stoppen war.
Durch
die Nase rann es unaufhörlich, und das geschluckte Blut musste ich in schwarzen
Klumpen erbrechen.
Gegen
Mittag des Freitags standen drei Ärzte um mein Bett herum, konnten mir aber
nicht helfen; das Blut floss immer weiter.
Am
frühen Nachmittag waren sie sich einig, dass Hilfe nur in einem Krankenhaus zu
erwarten war, vor allem auch deshalb, weil noch hohes Fieber dazu gekommen war.
Meine
Mutter ging dann zum „Schreiner-Weiß“ rüber und fragte ihn, ob er mich nicht
ins Krankenhaus nach Bruchsal fahren könnte.
Kurze
Zeit später stand er mit seinem Opel P4 vor unserem Haus, und etwa eine Stunde
später lag ich in einem Zwölfbettenzimmer im Bruchsaler Krankenhaus.
Am
nächsten Morgen kam eine Ärztin und „fuhrwerkte“ mit einer langen, an der
Spitze heißen Nadel, in den oberen Arealen über der Nasenwurzel herum.
Es
roch komisch und tat höllisch weh, aber das Blut versiegte.
Nach
Hause konnte ich aber nicht, denn das immer noch hohe Fieber ließ eine Entlassung nicht zu.
Im
Laufe des Samstags stellte man dann fest, dass es seine Ursache in einer
starken Lungenentzündung hatte.
Penicillin
gab es damals schon, allerdings nicht für Arbeiterkinder.
Die
Ärzte griffen dann zu einer Prozedur, die ich nie vergessen werde.
Zweimal
am Tag erschienen eine Krankenschwester und zwei Pfleger.
Ich
musste mich auf den Bauch legen, die Pfleger hielten mich an beiden Armen fest,
und die Schwester legte mir ein mit einem braunen Sud überzogenes Leinen auf
den Rücken.
Bereits
beim ersten Kontakt empfand ich meinen Rücken nur noch als eine schmerzende
Hölle und schrie wie am Spieß.
Wie
ich später erfahren sollte, war die braune Masse ganz stinknormaler Senf, und
was mir jetzt auch klar wurde, war der Umstand, warum für diese Prozedur zwei
Pfleger notwendig waren, denn ohne ihr Festhalten hätte wahrscheinlich niemand
solche Pein ausgehalten; so half all mein Brüllen und Strampeln nichts, ich
musste einfach durchhalten.
Nach
etwa ein bis zwei Minuten hob die Schwester das Tuch wieder von meinem Rücken
ab, reinigte ihn und bestrich ihn mit einer Salbe.
Kurzum:
Diese
Prozedur musste ich täglich eine Woche über mich ergehen lassen, stellte aber
fest, dass die Schmerzen von Tag zu Tag weniger wurden; am Ende der Woche
spürte ich überhaupt nichts mehr, und das Fieber war verschwunden.
Nach
zwei Wochen brachte mich ein Ambulanzwagen nach Hause, wo ich noch eine weitere
Woche im Bett lag und von meiner Mutter mit Hühnerbrühe und „Ei im Wein“ wieder
aufgepäppelt wurde.
Konfirmiert
war ich aber immer noch nicht.
Drei
Wochen später sollte die Aktion dann durchgeführt werden; der Großteil meiner
Klassenkameraden-/innen nahm daran teil, alle in ihrem Konfirmandendress.
Ich
bin ihnen heute noch dankbar dafür.
Was
mich aber bis heute noch irritiert und ärgert, war das Verhalten von Pfarrer
Schwarz.
Zwei
Tage vor der Einsegnung bat er mich zu sich ins Pfarrhaus und besprach mit mir
den Ablauf.
Wir
vereinbarten auch genau die Texte, die er mich abfragen wollte.
Als
ich aber bei ihm auf dem Altar stand, vergaß oder ignorierte er unsere
Abmachung und frage mich kreuz und quer durch Gesangbuch, Bibel und
Katechismus, weit über zehnmal.
Falls
er mich bloßstellen wollte, hatte er keinen Erfolg damit, denn ich wusste
alles.
Zu
seinen Gunsten unterstelle ich ihm eine kurze Phase der Vergesslichkeit.
Zweihundertundzwölf
Mark erbrachten die Spenden meiner Verwandten, die sich am Sonntag nach der
Einsegnung in unserem Wohnzimmer zu einem Festessen versammelt hatten.
Exakt
diesen Betrag gab ich für einen bis zu diesem Punkt meines Lebens einmaligen
und wunderschönen Gegenstand aus: einem Fahrrad.
Woher
ich den Prospekt oder den Katalog hatte, weiß ich nicht mehr, aber auf jeden
Fall bestellte ich ein grünes Herrenrad der Marke „Tripad“ mit einer
3-Gang-Torpedo-Kettenschaltung; zwei Wochen später schob es Herr Belschner gut
verpackt aus der Güterhalle beim Bahnhof, und ein paar Minuten stand es in
unserem Hof. Ich konnte es kaum fassen.
Ich
befreite es aus dem Karton, schraubte die Pedale und die Lichter an, stellte
die passende Sattelhöhe ein und drehte die erste Runde um die „Bäreninsel“.
Diesem
Objekt galt in den nächsten 18 Monaten meine ganze Zuwendung und Aufmerksamkeit
(was in der Folge allen meinen fahrbaren Untersätzen widerfuhr).
Es
war ständig auf Hochglanz poliert, und jeden Abend transportierte ich es in
unser Wohnzimmer.
Jeden
Tag flitzte ich mit durch das Dorf und darüber hinaus.
Später
stattete ich es noch mit einem Tachometer aus.
Die
erste größere Tour unternahm ich mit ihm am 1.Mai 1954 zusammen mit einigen
Klassenkameraden nach Besigheim.
Im
Frühjahr 1956 wurde es durch mein "Quickly“ ersetzt.
Mein
Vater benutzte das Fahrrad noch einige Jahre zur Fahrt an seine Arbeitsplätze
an den Bahnwärterhäuschen, aber dann stand es jahrelang vergessen irgendwo
herum, bis ich es 2005 gründlich reinigte, zerlegte und auf den Speicher im
Ballreich 4 verfrachtete; dort liegt es noch heute.
-
Biberach –
In
Stellung
Meine
Mutter hatte zwei ältere Schwestern: Alma und Rosa.
Wie
anfangs des letzten Jahrhunderts üblich, wurden viele Mädchen der unteren
Schichten „in Stellung“  geschickt, d.h., sie arbeiteten und wohnten bei
Großbürgern und Adligen als Dienstmädchen.
geschickt, d.h., sie arbeiteten und wohnten bei
Großbürgern und Adligen als Dienstmädchen.
Es
muss um das Jahr 1928 gewesen sein , als man Rosa zu einer
Pfarrersfamilie nach Biberach an der Riß schickte; wie und von wem dieser Deal
eingefädelt wurde, entzieht sich meiner Kenntnis.
Nach
einigen Jahren in der Martin-Lutherstr.8 in Biberach kam Rosa wieder nach
Ochsenburg zurück, und ihre Schwester Alma nahm ihre Stelle ein.
Diese
hielt es bei Pfarrers aus verschiedenen Gründen nicht lange aus; einer davon
muss Heimweh gewesen sein.
Also
musste Rosa wieder ran.
Sie
blieb dann den Rest ihres Lebens in der Martin-Lutherstraße, allerdings im Haus
mit der Nummer 13.
Dort
war die Frau des Eigentümers Konrad Grözinger gestorben, und Rosa nahm ihren
Platz ein.
All
diese Schicksale sollten sich auch auf mein Leben auswirken, denn viele
Erlebnisse und Begebenheiten – positive wie unerfreuliche – verbinden mich noch
heute mit diesem Ort.
1944
fuhr ich zusammen mit meiner Mutter zum zweiten Mal über Heilbronn, Stuttgart
und Ulm nach Biberach; Opa Schmol war gestorben und in der „Guten Stube“
aufgebahrt worden.
Als
wir vor dem Sarg standen, und meine Mutter mich darauf hinwies, dass der arme
Opa jetzt nichts mehr sehen konnte, gab ich laut vernehmlich den Rat von mir,
dass man ihm doch einfach eine Brille aufsetzen solle.
Ich
vermute, pflichtbewusst dokumentierte sie durch Mimik und Gestik ihre Scham
über das ungezogene Verhalten ihres Vierjährigen.
- Schützenfest -
Durch
die Tätigkeit meines Vaters bei der „Eisenbahn“ waren wir alle ausreichend mit
"Freischeinen“ versorgt, so dass unsere Fahrten nach Oberschwaben immer
kostenlos waren.
Am
schönsten waren die Besuche anlässlich des berühmten Biberacher
„Schützenfestes“.
Zwei
Wochen lang feierten sie es in vielfältigster Art und Weise:
Mit
einem kilometerlangen Umzug, Theateraufführungen, Wettspielen, kulturellen
Darbietungen, Zunfttänzen, Platzkonzerten, Biberschießen, Lagerleben,
Gauklerfesten und einem großen Vergnügungspark oben auf dem
"Giglberg".
Neben
diesen nahezu jährlichen Besuchen war ich immer wieder mal zu Besuch bei
"Rosatante“, manchmal nur für ein paar Tage.
Nur
einmal nahm diese Phase eine andere Dimension an: vier Wochen meiner
Sommerferien 1950 durfte/sollte ich in der Martin-Lutherstr. 13 verbringen.
Es
wurde die schmerzlichste Zeit meines jungen Lebens.
Zusammen
mit meiner Schwester brachte mich Mutter nach Biberach.
Als
ich sie in Begleitung von Rosatante ein paar Tage später zum Zug für die
Rückreise zum Bahnhof begleitete, spürte ich zum ersten Mal dieses beklemmende,
bis dahin unbekannte Gefühl, das mich vier Wochen beherrschen und belasten
sollte.
Als
dann der Zug in der Ferne und in Rauchschwaden entschwunden war, überfiel es
mich gewaltig.
- Heimweh -
Alles,
was sich Konradonkel, Rosatante, ihr Sohn Bertl und seine Frau Traudl in den
nächsten Tagen und Wochen an Ablenkungen einfielen ließen, half mir in keinster
Weise; das Heimweh war übermächtig, ließ keinen Raum für anderes.
Ich
reagierte auf keine Ermunterung, keine angebotene Unternehmung und wandelte wie
paralysiert durch die Tage.
Ich
markierte auf einem Kalender die verflossenen Tage, verschmähte das beste
Essen, lief immer wieder zum Bahnhof und sehnte mich in die Richtung Ulm und
Stuttgart abfahrenden Züge, hatte sogar an den Spielen des FV Biberach auf dem
Giglberg keinen Spaß und wollte nur eines: nach Hause.
Wie
viele Male zog ich das von Bertl bereit gestellte Grammophon auf, legte die
einzige vorhandene Platte darauf und lauschte dem „I hab rote Haar, feierrote
Haar sogar“, nur um wieder mal etwa zwei Minuten hinter mich zu bringen.
Meine
Briefe nach Hause wurden nicht beantwortet. Es half alles nichts.
Aber
auch diese vier Wochen gingen rum, und als dann mein Vater, meine drei
Schwestern und meine Kusine Heidi aus dem Zug stiegen, sah die Welt wieder
anders aus. Erleichtert – auch im wahrsten Sinn des Wortes – gab ich ihnen die
Hand, und zusammen machten wir uns auf den Weg zur Martin-Luther-Str.13.
Nach
einem weiteren Tag bei " Rosatante“ starteten wir eine denk- würdige Heimreise. Da die Raddampfer
auf dem Bodensee im Besitz der Eisenbahn waren, hatten auf ihnen auch unsere
Freischeine Gültigkeit.
Diesen
Umstand wollte mein Vater ausnützen und seiner Schar auf der Rückreise
Interessantes bieten.
- Heimfahrt -
Wir
fuhren also mit dem Zug von Biberach zum Stadtbahnhof Friedrichshafen, wo wir
in die „Hafenbahn“ wechseln mussten, die in wenigen Minuten die zwei Kilometer
zum Bodensee zurücklegte.
Als
wir ausstiegen, und ich auf diese für mich unvorstellbar riesige Wasserfläche
hinaussah, erklärte mir sich der Begriff "Staunen" von alleine; es
war unfassbar.
Plötzlich
entdeckte ich ein Schiff und wiederum war nur dieses eine Wort angemessen: Es
war die „Hohentwiel“, ein alter Raddampfer, ein wunderschönes, mächtiges
Schiff.
Wir
liefen noch eine Stunde auf dem Kai hin und her, zeigten dann beim Betreten der
"Hohentwiel" unsere Freischeine und waren plötzlich an Bord dieses
stolzen Schiffes.
Wir
standen gerade am Treppenaufgang zum hinteren Deck, als wir lautes, ängstliches
Schreien vernahmen: Meine Kusine Heidi stand draußen vor der Gangway, weinte
und schrie fortwährend nur den einen Satz: “Mamale, Mamale, do geh i net nei“.
Wir
mussten zurück und ihr minutenlang gut zureden, bis sie sich schließlich
überwand und doch an Bord kam.
Wir
überquerten den Bodensee, legten am Hafen in Konstanz an und fuhren mit einem
Lokalzug nach Radolfzell. Dort sollten wir in den Schnellzug nach Karlsruhe
einsteigen.
Doch
dieser ließ auf sich warten.
Als
er dann endlich aus Konstanz kommend in den Bahnhof einfuhr und dabei die
angezeigte Abfahrtszeit um mehr als zwei Stunden überschritte hatte, war klar,
dass wir in Karlsruhe unseren Anschlusszug nach Sulzfeld an diesem Tage nicht
mehr erreichen würden.
Dem
war auch so.
Obwohl
wir von den Sehenswürdigkeiten einer der schönsten Bahnstrecken in Deutschland
nichts mitbekamen–ich bin später oft auf dieser Route mit meinen Klassen zum
Bodensee gefahren- erreichten wir kurz vor Mitternacht müde den Hauptbahnhof in
Karlsruhe.
Zum
Glück hatte die Bahnhofsmission noch geöffnet; in ihr konnten wir bis zum
nächsten Morgen unterkommen, bis wir dann den Dampfzug auf seinem Weg nach
Heilbronn in Sulzfeld verließen.
Vier
lange – teilweise leidvolle – Wochen waren für mich zu Ende gegangen.
- Beim Sponerbauern -
Es
muss 1955 gewesen sein, als ich wieder mal einen Freischein erbettelte, als
Fahrtziel "Biberach an der Riß“ eintrug, meinen Sportsack packte und über
Heilbronn, Stuttgart und Ulm zu "Rosatante" fuhr.
Es
war im Sommer, denn ich weiß noch, dass ich am Tag nach der Ankunft zusammen
mit Rosatante an dem gerade im Bau befindlichen Freischwimmbad vorbei hinauf
nach Bergerhausen marschierte; das Becken war nur in seinem tiefsten
Bereich mit Wasser gefüllt, aber ein paar Wasserratten plantschten darin herum.
In
dem hoch über Biberach liegenden kleinen Bauerndorf Bergerhausen wohnte eine
Tochter von Rosas Mann Konrad.
Sophie
hatte einen Bauern („Sponerbauer“) geheiratet, war Mutter von fünf Töchtern und
war froh um jede Hilfe – vor allem während der Erntezeit.
Während
Rosatante sich um die Kinder und den Haushalt kümmerte, fuhr ich mit dem
Sponerbauer und seinem Knecht auf dem Traktor hinaus auf die Felder, um die zu
wigwamartigen Gebilden aufgestellten Garben aufzuladen und in die Scheune zu
verfrachten.
Da
mir diese Arbeit von zuhause bekannt war, und ich mich demzufolge nicht
„dabbich“ anstellte, konnte ich die anerkennenden Bemerkungen des Sponerbauern
und seines Knechtes nicht ganz verstehen; gut taten sie trotzdem.
Der
Lohn der Arbeit war abends dann ein deftiges Essen in der großen Stube.
Wenn
wir dann Glück hatten, konnten "Rosatante" und ich auf der
Ladepritsche des Milchautos hinunter in die Stadt fahren und sparten uns so den
langen Rückweg.
An
manchen Tagen war es auch so, dass ein oder zwei der Mädchen in die
Martin-Lutherstraße 13 gebracht wurden und dort einige Tage von Rosatante
versorgt wurden.
Ich
kann mich erinnern, dass ich oft stundenlang mit Heidi und Elke in der Küche
auf dem Boden rumrutschte.
Über
viele Jahre erstreckten sich diese Besuche in Bergerhausen, aber relativ früh
verstarb dann der "Sponerbauer"; ich kannte ihn nur als einen gebückt
gehenden, von der jahrelangen schweren Arbeit gekennzeichneten Mann.
Sophie
wurde weit über 80 Jahre alt.
Durch
den Verkauf ihrer vielen Äcker waren sie sehr reich geworden; die wachsende
Industrie („Liebherr“, „Boehringer Ingelheim“, etc.) und die damit sich
vermehrende Bevölkerung verlangten nach Bauland für Wohnhäuser und Fabriken.
Mit meinem kleinen Campingbus kam
ich in den vergangenen Jahren immer wieder mal nach Biberach und fuhr dann auch
natürlich nach Bergerhausen hinauf. Das große Bauernhaus steht noch, die
Scheune auf der anderen Straßenseite musste einem Neubau weichen. In ihm wohnt
Sophies Tochter Elke mit ihrem Mann.
Wenn
ich nicht gerade in Bergerhausen oder mit Elke und Heidi beschäftigt war,
unternahm ich doch noch so einiges.
Zwei
dieser Aktionen möchte ich noch kurz erwähnen.
- Glück gehabt! -
Zum
einen das Erlebnis an/in der Riß.
Es
war Sommer und sehr heiß.
Da
das erwähnte Freibad eine Abkühlung noch nicht zuließ, musste die Riß als
Ersatz herhalten.
Dieses
8-10 m breite Flüsschen hatte man in Richtung Jordanbad aufgestaut und
ermöglichte so den Biberacher Kindern und Jugendlichen das Vergnügen einer
erfrischenden Abkühlung.
Also
machte auch ich mich auf den Weg hinaus zu diesem erquickende Labsal
versprechenden Örtchen, wo sich bereits Dutzende Kinder tummelten.
Ich
zog mich um, verstaute meine Habseligkeiten unter dem kleinen Handtuch, das mir
Rosatante mitgegeben hatte, und beobachtete dann eine Weile das Treiben an dem
Flüsschen, vor allem an dem zu einer Art Sprungbrett umfunktionierten schmalen
Brett, das etwa 2 m in den Fluss ragte.
Ich
sah immer wieder Kinder, die kleiner waren als ich, und die mit dem Ausruf:“
Ich kann nicht schwimmen“ vom Brett in den Fluss sprangen.
Da
auch ich nicht schwimmen konnte, dachte ich aber: “Was die können, kann ich
auch“.
Als
ich auf dem Brett stand und mich tastend vorwärtsbewegte, zwangen mich die
ungeduldigen Rufe der Nachdrängenden zum Springen.
Ich
tauchte ein, stand auch mit den Füßen auf dem Grund, der Kopf ragte aber nicht
über das Wasser; es fehlten etwa 10 bis 20 cm.
Ich
bekam panische Angst und stieß mich immer wieder vom Boden in die Höhe, um Luft
zu schnappen.
Dieses
mehrmalige und verzweifelte Gezappel mussten zwei Jungen bemerkt haben, denn
sie sprangen ins Wasser und schleppten mich ans Ufer.
Sie
brachten mich zu meinem Handtuch, beruhigten mich und blieben noch eine Weile
bei mir.
Von
der Riß aber hatte ich die Nase voll und trabte nach Hause.
Die
nächsten Tage allerdings trieb mich die Angst vor einer damals akuten
Polioerkrankung um.
Das
zweite Erlebnis war angenehmerer Art.
Früh
morgens fuhr ich mit dem Zug über Ravensburg und Friedrichshafen nach Lindau,
wo ich mir in der Altstadt und am Hafen bis zur Abfahrt des Linienschiffes nach
Konstanz die Zeit vertrieb.
Faszinierend
war dann die Fahrt mit dem Raddampfer, der durch die beiden seitlich
angebrachten Räder vorwärtsgetrieben wurde.
Im
Inneren konnte man die mächtigen Kurbelwellen arbeiten sehen.
Da
mich Technik schon immer sehr interessiert hatte, kam ich aus dem Staunen nicht
mehr heraus. Über Wasserburg, Langenargen, Friedrichshafen, Immenstaad, Hagnau
und Meersburg erreichten wir am frühen Nachmittag den Hafen von Konstanz; dort
sah ich auch zum ersten Mal das Denkmal von Johannes Hus, der in Konstanz
verraten und verbrannt wurde, eines der unzähligen Opfer der Nachfolger
Christi.
Mit
einem weiteren Schiff fuhr ich wieder hinüber nach Friedrichshafen, um dann am
Abend wohlbehalten mit dem Zug in Biberach anzukommen.
Bis
zu ihrem Tode im Jahre 1984 war ich viele Male Gast bei Rosatante, und auch
auf
unserem Weg in den Urlaub nach Süden machte ich zusammen mit meiner Frau öfter
Station in Biberach.
Auch
wenn wir völlig überraschend auftauchten, empfing sie uns immer freundlich und
gab uns das Gefühl, dass wir willkommen seien.
Sie
war ein liebenswerter und herzensguter Mensch.
-Dobel-
Es gab nichts, überhaupt nichts.
Niemand wurde über die Fahrtroute
informiert, es wurden keine Zwischenstopps vereinbart, es gab weder Anweisungen
für irgendwelche Notfälle noch Informationen zu erreichbaren Telefonnummern –
es gab eben nichts; außer dem Ziel wusste keiner von uns irgendetwas Näheres.
Uns.
Das war eine Gruppe von fünfzehn
14-15-jährigen Buben, die unter der „Verantwortung“ des Sohnes unseres hiesigen
Pfarrers mit den Fahrrädern nach Neusatz auf den Dobel fahren wollte, um dort
vier Tage an einer Freizeit teilzunehmen.
Ich denke, es war im Mai/Juni 1954, als wir
den Platz vor der Kirche verließen und Richtung Kürnbach radelten.
Der Leiter der Gruppe hatte kurz zuvor noch
seinen Anorak auf meinem Gepäckträger befestigt.
Schon der Anstieg nach dem Ortsschild riss
Lücken in die Gruppe, die steile Abfahrt nach Kürnbach hinunter sprengte sie
vollends; zu viert standen wir plötzlich am Ortseingang in Kürnbach und wussten
nicht mehr weiter.
Da eine Umkehr aus verschiedenen Gründen
nicht in Frage kam, radelten wir nach Oberderdingen.
Die genaue Route, die wir von da aus nach
Pforzheim genommen haben, weiß ich nicht mehr.
Ich vermute, wir sind über Großvillars,
Knittlingen, Ölbronn, Kieselbronn nach Pforzheim gelangt.
Ich weiß nicht mehr, wie wir es schafften,
den weiteren Weg zum Dobel rauszufinden und wie es uns gelang, auf der B294 an
Birkenfeld vorbei in Richtung Neuenbürg zu radeln.
Es war schon dunkel, und der wieder
einsetzende Regen hatte uns völlig durchnässt, als wir etwa 1 km vor Neuenbürg
linker Hand einen Heuschuppen erblickten und nach kurzer Beratung beschlossen,
in ihm die Nacht zu verbringen.
Eine Weiterfahrt war uns sinnlos
erschienen; wir hatten keine Ahnung, wie weit unser Ziel noch entfernt war.
Wir zogen als erstes trockene Klamotten an
und machten es uns auf dem Heu so bequem wie möglich.
Da es durch das Dach an einigen Stellen
tropfte, dauerte es etwas, bis wir alle doch noch einigermaßen trockene
Liegeplätze gefunden hatten. Ob wir in dieser Nacht viel geschlafen haben, weiß
ich nicht mehr.
Ohne etwas zu essen, verließen wir bei
Tagesanbruch den Schuppen und radelten an der Enz entlang nach Neuenbürg.
Zwischen Neuenbürg und Höfen verließen wir
die B294, bogen nach rechts auf die L340 und mussten dann 6 km mühsam unsere
Räder den steilen Anstieg nach Dobel hinaufschieben.
Gegen Mittag erreichten wir den
„Neusatzturm“ und die um ihn herum gruppierten Zelte.
Die erste – höchst besorgte – Frage unseres
„Gruppenleiters“ galt seinem Anorak.
Der war ihm wichtig; dass vier Kinder, für
die er verantwortlich war, nahezu 12 Stunden verschollen waren, interessierte
ihn nicht, diese Tatsache war ihm keine Frage wert.
Ein für mich heute noch inakzeptables und
unverständliches Verhalten.
(NB! Er wurde später Pfarrer).
Im oberen Geschoss des „Neusatzturms“
hielten wir uns dann lange auf und warteten, bis unsere Kleider wieder
getrocknet waren.
Die Nächte verbrachten wir auf dem klammen
Stroh in den großen Zelten.
Vier Tage später waren wir wieder zuhause.
Wenn ich mich richtig erinnere, erreichten
wir alle gleichzeitig unseren Heimatort.
Eines wundert mich noch heute: Dass unsere
Eltern damals nichts unternommen haben: heute unvorstellbar.
-
Geigenspiel -
Ich kann mir (eigentlich)
nicht vorstellen, dass meine Mutter das alles geplant hatte; man müsste es
sonst als genial bezeichnen.
Aber ich erinnere mich, dass
sie immer wieder in entsprechenden Situationen wie nebenbei erwähnt und bemerkt
hatte, wie gut es doch ihr Sohn mit Kindern verstünde und wie gut er mit ihnen
umgehen könne.
Kann es sein, dass es auch zu
ihrem "Plan" gehört hatte, als sie mir 1954 eine Geige bestellt hatte
(viele Lehrer spielten damals noch Geige)?
Und wenn, wie hatte sie es
geschafft?
Woher hatte sie den Katalog?
Sei`s drum.
Im Frühjahr stand eines Tages
der Briefträger mit einem Paket vor dem Haus, ein Paket aus München.
Als wir es in der Küche
auspackten, kam ein schwarzer, länglicher Kasten zum Vorschein, und schließlich
lag eine braune Violine mit Bogen und einer kleinen, runden Dose auf dem Tisch;
mit dem harzigen Knollen, den letztere enthielt, konnten wir nichts anfangen.
Wie ich damals reagiert habe,
würde mich heute noch interessieren, aber ich habe keinerlei Erinnerung mehr
daran: war ich erstaunt? überrascht? verärgert? verblüfft? ratlos?
Möglicherweise war von all dem
etwas dabei, ich weiß es einfach nicht mehr.
Nachdem einige Zeit vergangen
war, nahm ich den Bogen in die Hand und drehte an dem Knopf: die gelblichen
Haare spannten sich und wurden straff.
Als ich aber die Geige ans
Kinn legte und mit dem Bogen darüberstrich, gab sie keinen Laut von sich, so
lange ich es auch probierte.
Sicherlich enttäuscht, packte
ich alles wieder ein.
Nachmittags probierte ich es
nochmals: das Ergebnis war dasselbe.
Am nächsten Tag brachte sie
das Paket zur Post und schickte es nach München zurück.
Damit war für mich die
Geigenepisode beendet.
Umso überraschter war ich, als
einige Wochen später wiederum der Briefträger mit dem bereits bekannten Paket
vor der Tür stand.
Sie muss sich in der
Zwischenzeit bei Emil Weegmann* erkundigt haben, was es mit dem harzartigen
Brocken in der Dose auf sich hatte.
 Als die Violine wieder
spielbereit war, befahl sie mir, ein paarmal mit dem Bogen über den Harzbrocken
zu streichen; ein weißlicher Staub wirbelte auf.
Als die Violine wieder
spielbereit war, befahl sie mir, ein paarmal mit dem Bogen über den Harzbrocken
zu streichen; ein weißlicher Staub wirbelte auf.
Als ich dann mit dem Bogen
über die Geigensaiten strich, erklangen plötzlich schmerzliche Kratztöne, aber
immerhin war etwas zu hören. Die Geige „funktionierte“ und blieb somit da.
Aber was nun?
Sie hatte wieder einen Plan.
Ein paar Tage später eröffnete
sie mir, dass sie mit Emil Weegmann gesprochen hätte, und er bereit wäre, mir
Geigenstunden zu geben. Sie hätte mich bereits angemeldet.
Kurzum:
Die nächsten zwei Jahre
wanderte ich zweimal die Woche zur Luisenstraße, und Emil brachte mir
Grundlegendes im Violinenspiel bei.
Eine Mark und fünfzig drückte
sie mir für die Stunde immer in die Hand
Nach zwei Jahren meinte Emil
eines Tages, dass er mir nichts mehr beibringen könne und den Unterricht somit
beenden wolle.
Ich war schon etwas
überrascht, rechne ihm aber heute noch seine Ehrlichkeit hoch an.
Ich vermute, er hatte sich die
Grundbegriffe selber beigebracht, das war`s dann aber. Ihn selber spielen habe
ich nie gehört; sicherlich brauchte er auch das Geld.
*Emil Weegmann wohnte ein paar
Häuser von uns entfernt in der Luisenstraße.
Er war ein kleiner,
korpulenter Mann von etwa 30 Jahren mit den dicksten Brillengläsern, die ich
damals gesehen hatte.
Ich kann mich erinnern, dass
er während der Zeit, als gegenüber bei Fischers amerikanische Soldaten
einquartiert waren, manchmal abends und in der Nacht ihre Festivitäten - man
könnte auch sagen: Saufereien, etc. - mit Klaviermusik umrahmte.
Er muss meiner Mutter erzählt
haben, welche Bewandtnis es sich mit der Dose hatte, dass es sich um
Kolophonium handelte, ohne das die Bogenhaare zu glatt wären, um einen Ton zu
erzeugen.
Ich bin ihm trotzdem heute
noch sehr dankbar; er war ein guter, gütiger, hilfsbereiter Mensch, der ein
paar Jahre später starb.
Wie ging es weiter mit meinen
Geigenkünsten?
An meiner Schule (Progymnasium
Eppingen) hatte unser Musiklehrer Keiler ein kleines Streichorchester
gegründet.
Hauptsächlich waren Erwachsene
die Akteure, aber auch ein paar Schüler unserer Schule wirkten mit.
Neben Else Zorn und Beate Dörr
durfte auch ich mitfiedeln, allerdings reichte es nur zur „Zweiten Geige“.
Die Proben zu den Konzerten
waren immer an den Samstagabenden, und ich hatte oft Mühe, den letzten Zug um
22.30 Uhr noch zu erreichen.
Es war trotzdem eine
lehrreiche Lernphase.
1956 war meine Zeit am
Progymnasium Eppingen zu Ende (dieses führte nur bis zur Mittleren Reife; zum
Abitur musste man nach Bretten oder Sinsheim).
Ich entschied mich für
Bretten, aber am dortigen Melanchthon-Gymnasium gab es kein Orchester.
Irgendwie gefiel mir aber das
Rumfiedeln, so dass ich zuhause oft stundenlang die Saiten malträtierte, ohne eine Vorlage, nur intuitiv. Etüden und
lange Übungspassagen hasste ich.
Erst 1961 kümmerte sich an der
Pädagogischen Hochschule wieder jemand um mein Geigenspiel.
Frau Helmer erreichte mit
ihrer Gründlich- und Zähigkeit in zwei Jahren doch noch einiges, beklagte aber
immer wieder meine Übungsunlust.
Ein kleiner Lohn meiner Mühen
(und der Strategie meiner Mutter?) war das "Sehr gut" meiner
Prüfungslehrprobe in einer 1.Klasse 1963, zu dem der Einsatz meiner Geige nicht
unerheblich beitrug.
Die nächsten Jahrzehnte habe
ich die Geige im Unterricht ("Was? Sie spielen Geige? Na, dann
unterrichten Sie natürlich Musik!") als sehr hilfreich kennengelernt und
immer verwendet.
Ich kann nur hoffen, dass die
Zahl der Kinder, die mein Gegeige nicht als unzumutbar empfanden, doch etwas
größer ist als die Gegenpartei; damit wäre ich schon zufrieden.
Bogen und Geige hängen heute
noch an der Wand meiner Bude; die Saiten fehlen allerdings.
Ab und zu erwäge ich, das
"gute Stück" wieder zu restaurieren bzw. mir eine neue zuzulegen.
Vielleicht geschieht es noch.
Kleine Anmerkung:
1956 stellte mir die
Feuerwehrkapelle eine Trompete zur Verfügung, in deren „Gebrauch“ ich vom
damaligen Dirigenten Josef Rothmaier eingewiesen wurde.
Acht Jahre musizierte ich in
dieser Gruppe, marschierte bei Festzügen mit durch die Dörfer und half als
„Zweiter Trompeter“ bei der Darbietung von Konzerten (u.a. „Schwarzwaldmädel“)
und bei vielen anderen Aufführungen; bedingt durch die Heimat unseres
Dirigenten, überwog Musik aus dem Böhmerwald.
Noch heute habe ich beste
Erinnerungen an die Kameradschaft dieser Gruppe.
-
Nase -
Heute werde ich nur noch beim Blick in den
Spiegel morgens daran erinnert; sie ist aber völlig bedeutungslos, sie spielt
keine Rolle mehr: meine Nase.
Sie dürfte für meine Gegenüber in ihrer
knollenhaften, rotgefärbten und überdimensionierten Gestalt immer noch kein
schöner Anblick sein, wird aber entweder ignoriert, sanktioniert und als
einfach mal gegeben betrachtet; sie gehört eben zu ihm.
Es war ein langer Weg bis hierhin, und man
wird sich bestimmt auch wundern, warum hier meinem simplen Riechorgan so viel
Raum gewidmet wird.
Ich habe die Vermutung, dass die
nachfolgenden Ausführungen auch in einem größeren Komplex gesehen werden
könnten und darunter speziell wiederum unter dem Gesichtspunkt der Ästhetik.
Ich ertappe mich heute immer noch sehr oft
- nahezu immer - wie ich z.B. bei einem Stadtbummel mir entgegenkommende
Menschen blitzschnell nach bestimmten Kriterien in ihrem Antlitz absuche und
sie automatisch dann in - qualitativ abgestufte - verschiedene Kategorien
einsortiere. Ein schöner Mensch war und ist für mich etwas Besonderes.
Von wem und wann diese Vorstellungen eines
schönen Menschen beeinflusst und geprägt wurden, weiß ich nicht; gewiss nicht
durch irgendwelche Medien.
Interessant war auch die Erkenntnis für
mich, dass diese Idealform eines schönen Gesichts nicht an einen bestimmten
Typus gebunden ist.
Ich kann darin in jeder Variante fündig
werden:
in jeder Haar-bzw. Augenfarbe, ob ovale
oder mehr breite Gesichtsform, spielt keine Rolle.
Ich denke, es sind die Ebenmäßigkeit und
die Harmonie eines Gesichts, die ich suche und die mich im positiven Fall für
den Menschen einnehmen, und hier erhebt sich für mich die große Frage, die ich
mir immer wieder stelle:
Kann dieses manische
Qualifizierungsbestreben von Menschen bei negativem Ausgang auch eine mindere
menschliche Einstufung des Betreffenden nach sich ziehen? Kann es - vor allem
bei meinem Beruf - eine verminderte und nicht mehr objektive Leistungsbewertung
zur Folge haben?
Vor allem letzteres wäre fatal, furchtbar
und unerträglich.
Nach vielen unzähligen Stunden des Grübelns
in den letzten 15 Jahren denke ich folgendermaßen darüber:
Es ist nicht auszuschließen und
wahrscheinlich sogar sicher, dass ich Menschen anders - freundlicher,
nachsichtiger, toleranter, sympathischer - begegnet bin und sie auch anders
behandelt habe, wenn sie ganz oder annähernd dem von mir gesuchten Raster
entsprochen haben.
Ich bedauere diese Tatsache, kann sie aber
leider nicht mehr korrigieren (ein wenig Trost finde ich im Ergebnis eines
Vergleichs mit Kolleginnen, Kollegen und vielen anderen Menschen).
Zur zweiten Frage:
Ich schließe es aus, dass ich für irgendein
Kind bewusst und absichtlich aufgrund seines Aussehens oder Verhaltens eine
falsche Leistungsbeurteilung abgegeben habe.
Ich habe in Gedanken viele meiner
"schwarzen Schafe" auf dieses Kriterium hin überprüft; gefunden habe
ich nichts.
Natürlich bewegt sich das Ganze in einer
mehr oder minder breiten Grauzone, und es ist nicht auszuschließen, dass im
Grenzfall einer anstehenden Leistungsbeurteilung (z.B. bei einem Aufsatz) unter
Umständen nicht ganz adäquate Noten vergeben wurden.
Ob solche Dinge überhaupt zu vermeiden
sind, weiß ich nicht. Ich würde es sehr bedauern, wenn dem so gewesen wäre.
Sie haben mich sehr lange beschäftigt.
Nach diesem Abstecher wieder zurück zu
meiner Nase.
Es klingt sicher etwas unglaubwürdig und
suspekt, aber ich bin mir sicher, dass nichts oder nur wenig mein Leben so
beeinflusst hat wie meine Nase.
Es muss im Alter von 10 Jahren gewesen
sein, also 1950.
Wir - die "Bäreninselbande" -
waren damals wie auch in den darauffolgenden Jahren ständig auf der Straße,
spielten Fußball, Völkerball, "Treiberles", Verstecken oder mit
unseren Murmeln.
Dazwischen machten wir auch
"Bockspringen":
Einer von uns bückte sich, der andere
grätschte über ihn drüber, stellte sich vorne wieder hin, der andere grätschte
wieder drüber, usw.
Normalerweise ein harmloses, ungefährliches
Spiel, ja, wenn nicht einer von den "Springern" - es war Wolfgang A.
- nicht zu kurz gesprungen und auf meinem Genick gelandet wäre und mein Gesicht
in den damals aus Schotter, Kieselsteinen und Sand bestehenden Untergrund der
oberen Luisenstraße gequetscht hätte.
Ich weiß noch, dass ich einen starken
Schmerz verspürte, gepaart mit Schrecken und einem nicht gelinden Schock.
Ich lief nach Hause, meine Mutter reinigte
das blutverschmierte Gesicht und verklebte die Risse und Kratzer.
Zwei Wochen später war davon nichts mehr zu
sehen, und der Vorfall war vergessen.
Es muss 1-2 Jahre später gewesen sein, als
mir bei Sonnenschein auffiel, dass der Schatten auf meiner linken Wange länger
war als auf meiner rechten.
Wahrscheinlich schob ich diese Feststellung
immer wieder beiseite, musste mich aber doch irgendwann aufgerafft habe, mich
bewusst im Spiegel anzusehen (sicherlich kam/kommt dies in diesem Alter nicht
so häufig vor).
Dann sah ich sie:
Sie hatte in der Mitte einen Knick nach
links und einen nicht klein dimensionierten Buckel; also hatte ich eine Hakennase.
Diese Erkenntnis traf mich wie ein Hammer
und ließ mich fortan nicht mehr los.*
Irgendwann sprach ich meine Mutter darauf
an, aber - wie es ihre Art war - schob sie zunächst auch dieses Problem zur
Seite; das "Büble" wird es schon wieder vergessen.
Es vergaß es aber nicht und ließ ihr keine
Ruhe, so dass sie sich eines Tages gezwungen sah, mit mir zum Kähny in den
"Ochsen" zu gehen und ihm - unserem Dorfarzt - meine Nase zu zeigen.
Er betrachtete und befühlte sie kurz und
meinte dann sinngemäß, dass sie meine anderweitig vorhandene
"Schönheit" nicht beeinträchtige; ich soll mir keine Sorgen machen.
Die Nase sei medizinisch in Ordnung; dass
sie ein wenig windschief und mit einem Höcker im Gesicht steht, muss man so
hinnehmen und damit leben.
Damit war die Sache für ihn und meine
Mutter erledigt.
Aber gerade damit kam ich nicht mehr
zurecht.
Es wurde immer schlimmer.
Ich beobachtete jede und jeden, die/der
mich anschaute und versuchte aus den Gesichtern irgendwelche Reaktionen zu
erkennen; logischerweise überwogen die negativen Hinweise auf diesen
Schandfleck in meinem Gesicht.
Meine Nase war der dominierende Faktor in
meinem Leben geworden.
Ihr abseits aller Normalität sich
befindendes Aussehen reduzierte mein bis dahin doch relativ unbefangenes und
offenes Auftreten und Verhalten anderen Menschen gegenüber.
Ganz schlimm wurde es, als ich altersmäßig
in den Bereich kam, wo man plötzlich weiß, warum "im Schrank nicht nur
Hosen" hängen.
Ich vermied immer mehr Begegnungen und
Kontakte.
So kniff ich oft nur Minuten vor
vereinbarten Treffen, weil mich einfach die Angst vor der Reaktion der - in der
Regel femininen - potentiellen Kontaktpersonen vor der Begegnung abhielt.
Wenn sie doch nicht zu vermeiden waren,
fummelte ich mir während der Gespräche im Gesicht herum oder drehte meinen
Gegenübern die linke Gesichtshälfte zu, weil ich im Spiegel festgestellt hatte,
dass in dieser Position der Knick und die Schiefstellung der Nase nicht ganz so
ausgeprägt zu sehen waren (eine Mitschülerin - Mathilde Paa aus Gemmingen -
wies mich 1956 mehrmals auf dieses Verhalten hin und fragte nach dem Grund;
eine Antwort blieb ich ihr schuldig). Nahezu alle Bilder, die es ab 1955 von
mir gibt, sind so aufgenommen, dass hauptsächlich die linke Gesichtshälfte
sichtbar ist.
Ab 1958 muss diese für meine Integration in
Gruppen doch negative Fixierung auf einen Körperteil für mich doch etwas in den
Hintergrund getreten sein bzw. ihre beherrschende Bedeutung verloren haben,
denn ich hatte in der Schule, im privaten und sportlichen Bereich eine nicht
unbeträchtliche Anzahl von Kontakten (nicht zuletzt haben bei meiner Frau
anscheinend mein blaues Hemd und meine blauen Augen den Anblick der Knollennase
übertrumpft).
Ich muss also doch "gelernt"
haben, mit diesem Manko im Gesicht etwas toleranter umzugehen; möglicherweise
haben auch andere - "positivere" - Faktoren überwogen.
Erstaunlich ist aber für mich heute
trotzdem noch die Tatsache, dass ich es mir zutraute, mit diesem nicht zu
übersehenden Schönheitsmakel nahezu 40 Jahre lang vor 60 bis 80 - oft
kritischen - Augen zu agieren.
Ich denke und vermute, dass ich im Alltag
und vor den Klassen im Laufe der Zeit einfach "vergaß", dass da ein
solches Monstrum in meinem Gesicht thronte.
1972 machten gesundheitliche Probleme einen
Eingriff an der Nase notwendig.
In diesem Zusammenhang wollte man dann auch
die Schiefstellung und den Höcker beseitigen.
Beides gelang in Heilbronn nur
unbefriedigend; die gesundheitlichen Probleme habe ich heute noch.
Es ist müßig und absolut spekulativ, heute
- nach 65 Jahren - darüber zu sinnieren, was wäre wenn gewesen.
Sicher weiß ich aber, dass mir meine Nase -
in wichtigen Phasen meines Lebens - viele Sorgen und Ängste bereitet hat und so
manche Kontakte blockiert bzw. negativ beeinflusst hat.
Aber: was wäre wenn gewesen?!
*=Es ist mir heute noch absolut
unverständlich, dass meine Umgebung (Eltern, Geschwister, Freunde) diese doch
nicht zu übersehende Veränderung eines "herausragenden" Körperteils
nicht bemerkt - kann nicht sein! - oder einfach ignoriert haben; irgendeiner
hätte mich doch darauf ansprechen, mich darauf aufmerksam machen oder darauf
hinweisen müssen - nichts von alldem war geschehen. Warum?
- Autos
und Motorräder -
Ernst H. kam 1949 aus russischer
Gefangenschaft zurück: krank, kraftlos, enttäuscht, labil und müde. Ob er zu
diesem Zeitpunkt bereits Alkoholiker war oder erst später dieser Sucht verfiel,
weiß ich nicht mehr.
Nach einem Jahr unternahm er den Versuch,
in seinem gelernten Beruf als Kraftfahrzeugmechaniker wieder zu arbeiten.
In einer großen Garage konnte er sich
einrichten.
Woher er die Geräte und Werkzeuge bekommen
hatte, weiß ich nicht, aber als ich zufällig zum ersten Mal in die Garage kam,
war da schon allerhand vorhanden - nur kein Auto, das es zu reparieren galt.
Als wir Wochen später wiederum dort oben
rumtobten - beliebt waren im Herbst "Äpfelschlachten" und im Frühjahr
"Maikäfer jagen" - sah ich in der offenen Garage ein Auto stehen; es
war die "Isabella" (Borgward) von Herrn Jacobi, der mit Lotte
Friedrich verheiratet war und für die gleichnamige Schreinerei Möbel verkaufte.
Als ich etwas unschlüssig am Eingang
rumtrödelte, kam ein Mann aus einem neben der Garage stehenden Wohnhaus und
meinte, ich könne gerne hineingehen, wenn ich Lust dazu hätte.
Ich folgte dieser Einladung, und so fing es
an.
Die nächsten drei Jahre verbrachte ich
nahezu jede freie Minute in der Garage; die Basis für meine Technikbegeisterung
war da; diese Welt interessierte mich.
Sporadisch kamen auch andere unserer Gruppe
in die Garage und halfen.
Waren es zunächst reine Handlangerdienste -
ich kannte bald alle Schrauben und die dazu passenden Schraubenschlüssel und
hatte sie bereits vor seiner Aufforderung zur Übergabe in der Hand - waren es
später auch anspruchsvollere Arbeiten, die ich übernehmen durfte:
Das Wechseln des Wassers der
Scheibenwischeranlage, Öl nachfüllen, Zündkerzen ausbauen und mit der
Stahlbürste abschrubben, Reifenluftdruck überprüfen, Schmiernippel versorgen
und manch anderes.
Als zwei Jahre später seine
Alkoholkrankheit immer sichtbarer wurde, und er manchmal überhaupt nicht in die
Garage kam, übernahmen wir auch andere Arbeiten, bei denen wir ihm oft
zugeschaut hatte: Vergaser einstellen, Leerlaufdrehzahl regulieren oder
Batterien aufladen.
Technisch am Anspruchsvollsten war es, wenn
ein Auto neue Zylinderkopfdichtungen brauchte.
Da sie manchmal nicht zu beschaffen waren,
mussten sie aus Löschpapier hergestellt werden.
Es wurde eine Schablone aus Zeitungspapier
oder dünnem Karton angefertigt, zwei bis drei Lagen Löschpapier darübergelegt
und dann mit einer Rasierklinge die Form ausgeschnitten.
Diese Arbeit musste oft mehrmals im Jahr
durchgeführt werden.
Da es damals (1950/1952) nur einige Autos
in Sulzfeld gab (wir betreuten vor allem die Autos vom Schreinerweiß, der Firma
Fischer, vom Kappenernst, die "Isabella" vom Jacobi und den
"Adler" von Burgahns), kamen meistens Motorräder in die Werkstatt
(BMW R25-R51 und R67, NSU - Fox, Konsul, Quick, Horex - Regina, Zündapp - DB
202).
Natürlich mussten diese Fahrzeuge alle
bewegt werden, und so war es kein Wunder, dass wir nahezu alle mit 12/13 Jahren
ein Auto in die Garage rein-oder rausfahren konnten; mit den Motorrädern fuhren
wir auch die Luisenstraße runter und über die Friedrichstraße und die
Wilhelmstraße wieder zurück (mit einer Zündapp fuhren wir einmal über die
Feldwege zum Hägenich und über Zaisenhausen zurück).
Ernst ignorierte unser Tun.
Gegen Ende des Jahres 1953 kam er nicht oft
mehr in die Werkstatt; im selben Maße blieben auch die Kunden weg.
Das Ende unserer Zusammenarbeit mit ihm
hätte tragisch ausgehen können.
Im Sommer 1954 veranstaltete der
Fußballverein das erste große "Sportfest" nach dem Krieg. Zwei Tage
wurde rund um die Uhr Fußball gespielt, und wir waren nahezu ständig dabei.
Am späten Sonntagnachmittag hielten wir uns
hinter dem Tor nahe der Neuhöferstraße auf, als Ernst laut hupend mit dem Opel
P4 vom Schreinerweiß angefahren kam und uns wild gestikulierend aufforderte, in
das Auto zu steigen. Er wollte mit uns eine Spritztour machen.
Widerwillig und ängstlich stiegen
letztendlich fünf von uns ins Auto.
Außer mir waren das noch Werner Himmel (er
saß auf dem Beifahrersitz), Gerhard Fundis, Erwin Haas und Wolfgang Antritter.
Nach einem Aufsehen erregenden Wendemanöver
- er war betrunken - fuhr er mit uns unter Einbeziehung der gesamten Straße
über die "Wegling" nach Zaisenhausen, wo er in der Ortsmitte wendete
und dann anhielt.
Er stieg aus und befahl Werner, auf den
Fahrersitz hinüber zu rutschen, denn er sollte jetzt das Auto zurück nach
Sulzfeld steuern.
Alle seine Einwände und Beteuerungen, dass
er das nicht könne, nützten nichts.
In seinem Suff war Ernst keinen Argumenten
mehr zugänglich.
Nachdem er den Motor zwei-oder dreimal
abgewürgt hatte, fuhr Werner langsam durch die Hauptstraße von Zaisenhausen in
Richtung Sulzfeld.
Damals floss der Kohlbach etwa 200 m nach
dem Ortsausgang von Zaisenhausen noch ziemlich dicht an der schmalen
"Wegling" vorbei, und es kam, wie es kommen musste.
Plötzlich griff Ernst in das Lenkrad, Werner
verlor die Kontrolle über den P4 und fuhr einen
kleinen Abhang hinunter. Im Kohlbach blieb das Auto stecken.
Ich weiß noch, dass durch den Aufprall die
rechte Tür aufsprang, Ernst vom Beifahrersitz hinausgeschleudert wurde und
plötzlich im Wasser lag.
Wir kletterten aus dem Fond hinaus, über
ihn hinweg und durch das Wasser des Kohlbachs hinauf auf die Wiese.
Ernst bewegte sich nicht, Werner hing über
dem Lenkrad und weinte.
Wir zogen dann Ernst auf die Wiese und
halfen Werner aus dem Auto, das bis zu den Sitzen mit Wasser gefüllt war.
Inzwischen waren ein paar Spaziergänger
eingetroffen, die sich vor allem um Werner kümmerten, der starke Schmerzen auf
der Brust hatte. Die drei Speichen des Lenkrads und der Hupknopf waren deutlich
auf ihr abgebildet.
Irgendjemand musste Herrmann Fischer
benachrichtigt haben, denn eine Stunde später kam er mit dem
"Henschel" der "Lumpenzwick", zog den P4 aus dem Wasser und
schleppte ihn nach Sulzfeld.
Ich weiß es nicht mehr so genau, aber ich
denke, das war unser letzter Kontakt zu Ernst.
Ich kann mich auch nicht mehr daran
erinnern, wie dieser unglückliche Zwischenfall letztendlich ausging und wer für
die Folgen aufkam.
Man kann annehmen, dass Ernst H. ohne den
Alkohol in Sulzfeld seinen Weg gemacht hätte, denn seine handwerklichen
Fähigkeiten waren unbestritten, und der Autoboom stand vor der Tür; sicher
waren seine Kriegserinnerungen so belastend, sodass er die Flucht in den
Alkohol als einzigen Ausweg gesehen hatte.
Ich habe ihm einiges zu verdanken, denn er
hatte mir die Augen für die Welt der Technik geöffnet, und er war auch dafür
verantwortlich, dass Automechaniker lange Zeit noch mein Traumberuf geblieben
war.
Ernst wurde nicht alt.
Es muss bereits Anfang der 60er-Jahre
gewesen sein, als er tödlich verunglückte.
Mopeds und anderes……
1954 tauchten sie auf: die Kreidlers,
Zündapps, Puchs und vor allem die Quicklys, alle der Gattung „Moped“
zuzurechnen, und ein Jahr später fuhren bereits einige meiner Kumpel mit diesen
motorisierten „Fahrrädern“ durchs Dorf - von vielen beneidet, vor allem von
mir.
Ein Technikfreak wie ich - und trotzdem nur
mit dem Fahrrad unterwegs.
Aber es war nichts zu machen. Zwei
Hindernisse waren nicht zu überwinden: Finanzen und Alter.
Obwohl zweites immer noch nicht passte,
hatte ich im Frühjahr 1956 endlich meine Mutter so weit, dass sie einwilligte,
mir ein solches Vehikel zu kaufen.
Es wurde beim „Brunnen-Krüger“ bestellt,
kostete 550 Mark, war drei Wochen später da und war ein grünes Quickly, das mit
dem großen Tank.
Dieses doch simple Gerät mit seinen zwei
Gängen, dem kleinen Zweitaktzylinder (49 Kubikzentimeter), den 1,4 PS und
seinen 40 km/h Höchstgeschwindigkeit erschloss mir eine ganz neue Welt, denn
zum ersten Mal in meinem Leben konnte ich mich ohne Einsatz meiner eigenen
Muskelkraft vorwärtsbewegen; ich brauchte nur mit der rechten Hand einen Griff
leicht nach hinten zu drehen, und schon sauste ich davon.
Ich weiß noch, dass ich sofort nach
Kürnbach fuhr, am Sportplatz umdrehte und riesig gespannt war, ob es
tatsächlich den steilen „Kürnbacher Buckel“ hinaufschaffen würde; aber siehe
da, nach Runterschalten in den ersten Gang schnurrte das Fahrzeugchen klaglos
den Berg hinauf.
Eines der zwei Probleme war aber immer noch
da: mein Alter.
Mir - und zwei meiner Freunde - fehlten
noch etwa 6 bis 8 Monate bis zum 16.Geburtstag, denn erst ab diesem Alter war
man berechtigt - nach einer einfachen Eignungsprüfung - sich mit diesen
Kleinkrafträdern im Verkehr zu bewegen.
Es war natürlich klar, dass wir uns an
dieses Limit nicht hielten.
Die Dinger mussten bewegt werden, schon um
ihrer selbst willen; wer rastet, der rostet.
Also strebten mit beginnender Dämmerung
vier dieser flinken Gesellen auf getrennten Wegen zu einem vereinbarten
Treffpunkt, um dann gemeinsam eine kleine Rundfahrt zu starten; die Runde über
Mühlbach, Ochsenburg, durch den Wald nach Kürnbach und nach Hause zurück war
ihr Favorit.
Aber auch andere Dörfer und Ziel waren
nicht vor ihnen sicher.
Abends oder nachts war das Risiko einer
Kontrolle nahezu null, und tagsüber fuhren wir nur los, wenn wir wussten, dass
„Sheriff“ Weber sich in seinem Büro in der Friedrichstraße aufhielt.
Soweit ich mich erinnern kann, wurden wir
nie kontrolliert.
Als der Tag der „Volljährigkeit“ dann
endlich gekommen war, erweiterten wir unseren Aktionsradius doch beträchtlich,
und eines Tages tauchte irgendwie der Vorschlag auf, doch mal etwas „Größeres“
zu unternehmen.
Wir spekulierten anfangs, lästerten,
machten unsere Witze und hielten es in keiner Weise für ein ernst gemeintes
Unterfangen, bis ich mich dann doch der Sache annahm.
Klar: alle anderen waren täglich acht
Stunden an ihren Arbeitsplätzen, ich saß nur in der Schule rum - und das auch
nur vormittags.
Also „plante“ ich.
Mein Vorschlag wurde gut aufgenommen, und
so begannen wir mit den Vorbereitungen, denn allerhand musste noch angeschafft
werden: Gepäcktaschen und vor allem Regenklamotten.
Nach vielen „Sitzungen“ im „Engel“ war es
dann im August 1957 so weit.
Zusammen mit Friedolin und Willi startete
ich an einem sonnigen Samstag zu unserer Fahrt durch den Schwarzwald.
Über Mühlacker und Pforzheim erreichten wir
am späten Nachmittag Birkenfeld, wo wir auf einem Wiesenstück von Willis Onkel
übernachten konnten.
Durch den für mich damals von einer
großen Magie verklärten Schwarzwald
verklärten Schwarzwald ging es am nächsten
Tag weiter, und über Freudenstadt, Alpirsbach, Hornberg und Triberg erreichten
wir am späten Abend Furtwangen, wo wir auf einer Waldlichtung unser Zelt
aufschlugen, uns auf unserem Gaskocher eine schmackhafte Suppe zubereiteten und
dann müde in unsere Schlafsäcke krochen.
Nach einem längeren Stopp am Titisee -
inklusive Bootsfahrt und Eisessen - ging es am nächsten Tag über Lenzkirch,
Bonndorf nach Tengen, wo wir wiederum in der Nähe eines Waldes übernachteten.
Am Nachmittag des nächsten Tages erreichten
wir Friedrichshafen.
Nach einer kurzen Hafenrundfahrt mit einem
Tretboot suchten wir uns in Seenähe einen Übernachtungsplatz.
Nachdem das Zelt stand, marschierten wir zu
einem Gasthaus und ließen uns zum ersten Mal nach unserer Abfahrt wieder ein
warmes Essen schmecken.
Am nächsten Tag trennten wir uns.
Warum?
Ich litt schon damals unter massiven
Rückenschmerzen; ohne mehrmaliges Einreiben ging es nicht, und abends stank es
in dem kleinen Zelt bestialisch.
Keiner hatte sich bisher beschwert, aber
ich hatte den Eindruck, dass sie abends alles taten, um den Aufenthalt im Zelt
so weit wie möglich zu verkürzen.
Auch war es für drei Personen viel zu
klein; unser Geiz hatte uns eingeholt.
Yul und Willi waren nicht glücklich, als
ich sie informierte, nach Hause zu fahren, mir selber kam es auch wie eine
„Fahnenflucht“ vor.
Am nächsten Morgen verabschiedete ich mich
von ihnen und fuhr über Ravensburg nach Biberach zu meiner Tante Rosa.
Ich verbrachte bei ihr zwei Tage und
erreichte dann am dritten Tag abends - über Ehingen, Filderstadt und Pforzheim
- mein Zuhause.
Erstaunlich, welche Entfernungen man mit
einem solch kleinen Vehikel an einem Tag zurücklegen kann.
Fazit:
Die Fahrt durch den Schwarzwald war für
mich faszinierend und bestätigte die mannigfaltigen Bilder und Vorstellungen,
die durch viele Geschichten, Märchen und Legenden vorbereitet wurden.
Viele Fahrten in den vergangenen
Jahrzehnten in dieses eigenwillige Mittelgebirge verringerten mein Interesse
und meine Begeisterung nicht im Geringsten.
Garmisch-Partenkirchen
Wie bereits geschildert, war mein Vater
nach dem Krieg bei der „Eisenbahn“ beschäftigt.
Alle Angehörigen dieser Institution bekamen
sog. Freischeine, auch die einzelnen Familienmitglieder.
Daneben gab es auch die „Pfennigkarte“: mit
ihr bezahlte man für jeden Kilometer ca. 1 Pfennig.
Während den Beschäftigen der „Eisenbahn“
fünf Freischeine pro Jahr zustanden, gab es für ihre Frauen und Kinder jeweils
nur drei davon.
Natürlich verbrauchten wir sie alle; zum
Jahresende auch manchmal für eine Fahrt nach Heilbronn oder Karlsruhe, nur um
sie nicht verfallen zu lassen.
Die meisten davon gingen für Fahrten nach
Biberach drauf.
Später (1956 bis 1958) dienten sie mir
dazu, um Spiele der Deutschen Fußballnationalmannschaft zu besuchen, jedes Mal
ein begeisterndes Erlebnis.
Zusammen mit meinem Schulkameraden Herbert
(„Herle“) Kritter, dessen Vater ebenfalls bei der „Eisenbahn“ beschäftigt war,
besuchte ich am 22.12.1957 das Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen
Ungarn im Niedersachsenstadion in Hannover; es galt als „Rückspiel“ des
WM-Finales in Bern 1954 (Endstand: 1:0).
Jeweils 9 Stunden dauerte die Hin-und
Rückfahrt, bei der wir teilweise nur auf dem Boden sitzen konnten, aber es faszinierte
uns, Spieler wie Grosics, Bozsik, Hidekuti, Kocsis, Eckel, Juskowiak,
Szymaniak, Herkenrath und Schäfer spielen zu sehen; Sepp Herberger saß auf der
Trainerbank.
Am 19.3.1958 waren wir im Frankfurter
Waldstadion und sahen den 2:0-Sieg der Deutschen gegen Spanien (Alfredo Di
Stefano, Paco Gento und Luis Suarez waren die bekanntesten Spieler), und am
21.12.1958 fuhren wir ins Rosenaustadion nach Augsburg, wo Bulgarien 3:0
verlor.
Ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber der
Auslöser muss eine der damals beginnenden - oft heftigen – Diskussionen mit
meiner Mutter gewesen sein; auf jeden Fall füllte ich kurz entschlossen einen
Freischein aus, packte ein paar Klamotten in meinen Sportsack, stiefelte am
nächsten Morgen zum Bahnhof runter und fuhr mit dem Dampfzug zunächst nach
Heilbronn, von wo es dann über Stuttgart und Ulm nach München ging, das ich am
späten Nachmittag erreichte.
Die letzte Etappe führte dann von der
bayrischen Hauptstadt über Murnau zu meinem Endziel nach
Garmisch-Partenkirchen. Wie bei den Dampfzügen damals üblich, konnte man von
einem Waggon zum nächsten wechseln, musste aber eine sich im Freien befindliche
Metallplatte überqueren, was bei dem Geschaukel nicht immer einfach war.
Da
es ein wunderschöner Tag war, hielt ich mich auf der hinteren Plattform des
letzten Wagens auf und erblickte plötzlich etwas noch nie Gesehenes und für
mich Unfassbares in der Ferne: bis in den Himmel emporsteigende Felsmassive,
manche mit Schnee überzogen und in der Sonne glänzend.
Ich kam aus dem Staunen nicht mehr heraus und das Erste, was
ich nach dem Aussteigen in Garmisch tat, war, mich einfach hinzustellen und
diese noch nie gesehene „Welt“ anzuschauen (dasselbe war passiert, als ich 1950
mit der „Hafenbahn" vom Friedrichshafener Hauptbahnhof zum Hafen
hinausfuhr und plötzlich vor der riesigen Fläche des Bodensees stand).
Anschließend begab ich mich in die
„Eisenbahnerkantine“ in der Nähe des Hauptbahnhofs, wo ich mir mit meiner
„Pfennigkarte“, die auch als Ausweis diente, etwas zu essen kaufte.
Wie ich dann nach einem Besuch auf dem
Fremdenverkehrsamt feststellen musste, konnte ich mir ein Zimmer in dieser
Gegend nicht leisten.
Warum ich dann in den Bus nach Farchant
einstieg, weiß ich nicht mehr, fand aber dort bald darauf ein Zimmer in einem
kleinen Haus. Kostenpunkt: 2 DM pro Nacht.
Ich kann mich nur noch an den kleinen Tisch
erinnern, auf dem eine große Porzellanschüssel und ein mit Wasser gefüllter
Krug standen.
Am nächsten Morgen nahm ich den Bus zum
Bahnhof und besorgte mir einige Prospekte.
Ich beschloss, durch das Höllental zur
Höllentalangerhütte hinaufzuwandern.
Mit dem Bus ging es zunächst nach
Hammersbach und von da ab zu Fuß steil hinauf zur Höllentaleingangshütte, wo
ich den Eintritt bezahlte und mir einen Regenumhang auslieh.
Der Gang durch diese fantastische Schlucht
(ich bin sie Jahre später noch mehrmals gegangen, auch mit Klassen) war
grandios; ich hatte so etwas noch nie gesehen und kam aus dem Staunen nicht
heraus.
Nach etwa einer Stunde erreichte ich –
immer am tosenden Wasser des Hammersbachs entlang – die Höllentalangerhütte, wo
ich eine lange Rast einlegte und von der Terrasse aus den damals noch weit ins
Tal herunterreichenden Gletscher („Höllentalferner“) bestaunte.
Auf dem Rückweg sah ich einen nach rechts
weisenden Wegweiser mit der Aufschrift „Kreuzeck - 3 Std.“
Da es erst kurz nach 12 Uhr war, dachte
ich, diesen Abstecher eigentlich noch „mitnehmen“ zu können und begann den
Anstieg über den schmalen, steil aufwärts führenden Pfad.
Nach zwei Stunden war ich schweißnass, hatte
noch niemanden und nichts gesehen, vor allem kein „Kreuzeck“; ich war mitten in
einem ausgedehnten Latschenfeld.
Ich weiß nicht mehr genau, was dann
passierte, aber plötzlich rannte ich panikartig durch diese harten Gewächse und
war nach kurzer Zeit an allen unbedeckten Stellen des Körpers ziemlich
verkratzt und aufgeschürft.
Wahrscheinlich hatte ich auch geschrien,
denn plötzlich hörte ich jemanden rufen, und kurz darauf kam mir ein Ehepaar
etwas oberhalb auf einem Pfad entgegen.
Der Mann beruhigte mich, und wir gingen
dann alle zusammen wieder zurück zur Höllentalangerhütte, von wo ich nach
kurzer Pause meinen Weg durch das Höllental hinunter nach Hammersbach allein
fortsetzte.
Da mein Geld für Fahrten zum Kreuzeck oder
mit der Bayrischen Zugspitzbahn hinauf auf Deutschlands höchsten Berg nicht
ausreichte, trieb ich mich noch zwei Tage in Garmisch, in Partenkirchen und
rund um das Olympiastadion mit seiner riesigen Sprungschanze herum.
Am letzten Tag vor meiner Rückreise sah ich
in dem zu einem Fußballstadion umfunktionierten Olympiastadion noch ein
Freundschaftsspiel zwischen den Frauennationalmannschaften von Deutschland und
der Schweiz (8:0).
- Sport -
In irgendeiner Form trieb und treibe ich
heute noch „Sport“ oder treffender ausgedrückt: ich bewegte mich und bewege
mich noch heute.
Schon in der frühen Kindheit hielten wir
uns in jeder freien Minute im Freien auf, kletterten auf den Bäumen rum,
machten Wettrennen, spielten „Fangerles“ und „Versteckerles“, Völkerball,
Handball und vor allem Fußball, „Treiberles“, fuhren im Winter mit unseren
Schlittschuhen auf dem Eis in den Regenrinnen und den Bombentrichtern herum
oder waren mit unseren Schlitten im ganzen Dorf und auf den umliegenden Hängen
unterwegs und liefen immer wieder auch hinaus zu den benachbarten Wäldern und
hinunter zum Kohlbach, auf dem wir unsere geschnitzten Schiffchen bis zur
„Egonmühle“ begleiteten und dabei viele
Male über den Bach springen mussten.
Tägliche Bewegung war Bestandteil unseres
Lebens; nirgends schränkten parkende Autos, eingezäunte Grundstücke oder um die
Karriere ihrer Sprösslinge besorgte ehrgeizige Mütter unseren Bewegungsdrang
ein, und vor allem konnte uns damals der „Fortschritt“ in Gestalt von Handy,
Smartphone, Computer und Fernsehen noch nicht die Unmenge an Zeit „stehlen“,
wie es heute der Fall ist.
Es muss um das Jahr 1950 gewesen sein, als
ich mit einigen von meinen Freunden einmal pro Woche das von Alfred Guggolz und
Herrmann Mohr angebotene „Turnen“ im Turnhäusle beim Sportplatz besuchte;
Gymnastik und Übungen an Bock, Barren und Reck standen im Mittelpunkt.
Einige Jahre später beteiligte ich mich
auch an leichtathletischen Wettkämpfen in Sulzfeld, Eppingen, Sinsheim und am
„Bergfest“ auf dem Steinsberg bei Weiler.
An letzterem Ort war es auch das einzige
Mal, dass ich einen ersten Platz in der Disziplin „Weitsprung“ belegen konnte;
dieser Erfolg war aber nur der Abwesenheit des Abonnenten für diesen Platz,
Helmut Pfleger, zu verdanken.
Ansonsten galt: “Dabei sein ist alles“;
Spaß gemacht hat es mir trotzdem.
Meine Leidenschaft aber galt dem Fußball,
aber auch in dieser Sparte gilt das oben angeführte Motto.
Vorausgesetzt, wir konnten einen Gegenstand
auftreiben, der auch nur entfernt aussah wie ein Ball und auch die
Mindestanforderungen an dessen Eigenschaften erfüllte, bolzten wir auf den
Straßen der Bäreninsel herum, bevorzugt auf der Neuen Bahnhofstraße.
Anfangs bastelten wir die Bälle selbst, oft
aus Weidenruten, die wir um geformte alte Lappen bogen.
Später tauchten dann die ersten Gummibälle
auf; abwechselnd schaffte es einer von uns, seine Eltern zum Kauf dieses für
uns so wichtigen Gegenstandes zu überreden. Derjenige, der dies schaffte, war
dann der „Boss“, denn er bestimmte, wer mitspielen durfte und wann das Spiel zu
Ende war.
1954 bekam ich den ersten Kontakt zum
Fußballverein.
Die A-Jugend wollte in Mühlbach ein
Freundschaftsspiel austragen, konnte aber keine vollzählige Mannschaft stellen;
nach mancherlei Zweifeln ließ ich mich zu einer Teilnahme überreden und fuhr
dann am nächsten Tag mit dem Fahrrad zusammen mit den anderen zum Mühlbacher
Sportplatz; ein Trikot und die Stutzen gab man mir, der Rest bestand aus meiner
kurzen Sporthose und meinen Sandalen.
Nach dem 23:0 für uns - die Mühlbacher
hatten nur sechs oder sieben Spieler zusammengebracht - hatte Schiedsrichter
Heinz Söder ein Einsehen und pfiff Mitte der zweiten Halbzeit ab.
Als meine Mutter abends mein
nachmittägliches Tun herausfand, wurde sie fuchsteufelswild und verbat mir
solches ein für alle Mal.
Solange ich unter ihrer Fuchtel stand,
blockierte sie mir diese Sportart mit allen Mitteln; als ich mir ein paar
Wochen nach dem Spiel in Mühlbach das Geld für ein Paar Fußballschuhe angespart
und dann bei Schuhmacher Mohr gekauft hatte, verbrannte sie mir diese kurze
Zeit später.
 Mit 16 gehörte ich trotzdem zum Kern der
A-Jugend und verpasste die nächsten drei Jahre kaum ein Spiel.
Mit 16 gehörte ich trotzdem zum Kern der
A-Jugend und verpasste die nächsten drei Jahre kaum ein Spiel.
Zur Meisterschaft im Kreis Sinsheim reichte
es aber nie, da die Eppinger immer besser waren; einen Wesolowski
auszuschalten, gelang weder mir noch anderen.
Mein Debut in der ersten Mannschaft des FV
Sulzfeld in einem Verbandsspiel in Bargen bedeutete auch gleichzeitig mein Ende
in diesem Verein.
Erst 1963 - nach der Versetzung an die
Grund-und Hauptschule im Nachbarort Mühlbach - schloss ich mich wieder einem
Verein an und spielte dann etwa 25 Jahre beim VFL in der zweiten und ersten
Mannschaft als rechter Verteidiger; zwei Abstiege aus der A-Klasse und die sich
anschließenden Wiederaufstiege ragen in dieser Zeit heraus.
In den letzten 10 Jahren beim VFL genoss
ich die tolle Stimmung und Kameradschaft bei den „Alten Herren“.
Nach der Erlangung des Trainerscheins 1976
an der Sportschule war ich auch noch fünf Jahre als
Schiedsrichter für den Verein tätig.
Ich habe nur beste Erinnerungen an den
Verein und die Mühlbacher und möchte diese Zeit nicht missen.
Im Frühjahr 1975 machte ich Bekanntschaft
mit einer weiteren Sportart, welche die nächsten 23 Jahre meines Lebens
wesentlich (mit-) prägen sollte: das Spiel mit der kleinen Filzkugel - Tennis.
Zusammen mit meinem Schwager Horst und
weiteren Freunden hatte ich seit 1970 regelmäßig in einem Raum der
„Volksschule“ Tischtennis gespielt.
Bei einer der sich anschließenden
„Pflichtsitzungen“ im Gasthaus „Hirsch“ nahmen wir zwangsläufig an der an den
Nebentischen gerade tagenden Gründungsversammlung der Tennisabteilung des
Turnvereins teil.
Was sich diesem Abend alles noch im
Einzelnen ereignet hatte, weiß ich nicht mehr, aber auf dem Nachhauseweg trug
ich jedenfalls eine unterschriebene Beitrittserklärung in der Tasche; nach 17
Jahren war ich wieder ein Teil des Turnvereins geworden.
Es bedürfte allein einer kleineren
Broschüre, um all die Aktivitäten und die Zeit zu schildern, die ich in den 23
Jahren bis zu meiner Erkrankung im Jahre 1998 in diese Sportart investiert
habe.
Nachdem ich unter der Anleitung von Dieter
Hikl die ersten „Gehversuche“ hinter mich gebracht hatte und es schaffte, die
Filzkugel wenigstens ein paarmal über das Netz zu befördern, zogen mich die -
anfangs zwei - roten Rechtecke am Ende der Neuhöferstraße magisch an; jede
freie Minute trieb ich mich auf ihnen - und später auch anderen - herum.
Nach zwei Jahren waren wir im Stande, eine
Mannschaft zu den Medenspielen - so heißen die Verbandspiele in der
Tennisbranche - anzumelden, konnten am Ende aber nur den internen Titel
„Sulzfeld Nullneun“ erringen, denn wir hatten kein einziges Spiel gewonnen.
Obwohl sich dieser Zustand auch in den
nächsten beiden Jahren nicht wesentlich änderte, gaben wir nicht auf und
schafften im fünften Jahr den Aufstieg in die nächst höhere Klasse.
Nach 10 Jahren waren wir zwei weitere Male
aufgestiegen.
Meine Tätigkeit als Trainer und Sportwart
verlangte doch einigen Zeitaufwand.
Nach dem B-Schein im Fußball erhielt ich
1982 nach zwei Lehrgängen an der Sportschule Ludwigsburg und zwei weiteren an
der Sportschule Schöneck auch die Trainerlizenz im Tennis.
Große Erfolge stellten sich nicht ein; die
Tätigkeit als Tennistrainer ermöglichte mir aber die Finanzierung meiner Reisen
und weiterer Hobbys.
1998 kam dann mit meinen Herzproblemen das
abrupte Ende; aus Enttäuschung darüber kündigte ich alle Mitgliedschaften und
zog mich völlig zurück.
Die nächsten 10 Jahre zwang mich meine
Pumpe zur nahezu völliger Abstinenz sportlicher Tätigkeit; erst 2008 - nach
verschiedenen Interventionen an diesem Zentralorgan - ermöglichte mir mein
erstes E-Bike wieder umfangreichere Aktivitäten, die ich heute noch pflege.
- Reisen –
Woher letztendlich meine Motivation nach
der Sehnsucht in die Ferne resultierte, weiß ich nicht; ich denke, mehrere
Konstellationen könnten auf die Entstehungsgeschichte dieses Verlangens
hindeuten.
Im Herbst 1954 legte uns Herr Türck, unser
Geographielehrer am Progymnasium Eppingen, den Kauf des Diercke-Weltatlasses
nahe, präziser, er verlangte von uns den Erwerb dieses nicht ganz billigen
Kartenwerkes.
Anscheinend war mein Wunsch bzw. der Druck
von Karl Türck so groß, sodass dieses in dunkelgrüner Farbe gehaltene
Kartenwerk bereits zwei Wochen vor dem Heiligen Abend in meinem Besitz war; es
nahm ab sofort eine zentrale Funktion in meinem Alltag der nächsten Tage und
Wochen ein und liegt heute noch in meinem Regal.
Ich
schaute mir immer wieder die faszinierenden Bilder in diesem farbigen Abbild
unserer Erde und des Himmels an.
Auch mein Vater interessierte sich
allmählich für dieses Buch, so dass es im Laufe der Zeit zur Gewohnheit wurde,
nach dem Abendessen den Atlas auf den abgewischten Küchentisch zu legen.
Ich animierte ihn zu einem Suchspiel, mit
dessen Prinzipien er nach meiner Erläuterung einverstanden war.
Auch zwei meiner Schwestern beteiligten
sich anfangs; leider erlahmte ihr Interesse relativ schnell, sodass wir das
„Spiel“ alleine spielten.
Wie lief es ab?
Ganz einfach.
Mein Vater nannte einen aus der
aufgeschlagenen Seite ersichtlichen Begriff - den Namen eines Flusses, einer
Stadt, eines Landes, eines Berges, einer Meerenge - und wir Kinder versuchten,
ihn zu lokalisieren.
Dem „Entdecker“ wurde jeweils ein Punkt
gutgeschrieben.
Nachdem meine Schwestern die Segel
gestrichen hatten, spielte ich mit meinem Vater alleine weiter, oft jeden Tag
stundenlang; dafür bin ich ihm heute noch dankbar.
Eine weiterer Umstand forcierte mein
Interesse an unserem Planeten ganz entscheidend.
Ab 1952 lag jedem Kauf eines
Sanella-Margarinequaders ein Bild bei.
Die Bilder zeigten Menschen und Tiere der
ganzen Erde.
Für jeweils eine Mark konnte man die dazu
gehörigen Alben erstehen.
Ich kaufte mir zwei Alben: Afrika und
Südamerika.
Da es bei uns damals nur noch
Sanellamargarine gab, schaffte ich es in kurzer Zeit, die neben die Textstellen
markierten Freiräume mit den passenden Bildern auszufüllen.,
Beide Alben habe ich noch heute, und ein
Blick in sie begeistert mich immer wieder, denn Begriffe wie „Okapi“, „Piranha“
oder „Zuckerhut“ kannte ich vorher nicht.
Größere Reisen waren aber auch 1960 aus Geldmangel noch nicht möglich.
Erst im Sommer 1961 überquerte ich zum
ersten Mal die Grenzen Deutschlands; in einem Fiat 600 und einem „Käfer“ fuhr
ich zusammen mit fünf Freunden über den Großglockner nach Jesolo an die Adria,
wo wir auf dem Campingplatz „NSU Cavallino Lido“ zwei Wochen zelteten.
1965 fuhren Heidrun und ich über die
Schweiz und Südfrankreich an die Costa Brava, 1968 bestieg ich anlässlich
unserer Hochzeitsreise nach Teneriffa zum ersten Mal ein Flugzeug, die erste
Überseereise erfolgte 1977 nach New York.
Alle Reisen der nächsten 40 Jahre - 15
Jahren fuhren wir auch mit unserem Campingbus kreuz und quer durch Europa -
hier aufzulisten, wäre zu aufwändig.
Allerdings möchte ich folgende Reisen doch
kurz erwähnen, weil sie mich stark beeindruckten und formten:
Quer durch Israel und den Sinai mit Reiner
Vorberger, runter und rauf mit einem Mietwagen durch Ägypten mit Eckart,
zweimal Marokko und Tunesien, die zwei USA-Reisen mit Heidrun, meine Fahrten
mit Antje durch Kolumbien, Bangkok, Java und Bali, die
die
tollen Erlebnisse mit Kurt in Sumatra, Simbabwe, Ecuador, Tansania und hinauf
zum Kilimanjaro, die Mexiko-Reise mit Heidrun, Thailand- und Malaysiatour mit
Singapur/Hongkong, Bali mit Heidrun und die dreimalige Südafrikatour.
Warum
war Reisen ein besonderer Aspekt in meinem Leben?
War es eine Flucht? War es die Neugierde
auf Neues, Interessantes und Anderes?
Wollte ich meinen „Horizont“ erweitern?
Versprach ich mir ein besseres Image?
Erhoffte ich ein Gefühl von Glück und
Freiheit?
Neue Inspirationen?
Wollte ich meine Grenzen austesten?
Den Kopf frei bekommen und durchatmen?
Wieder merken, was man am „Zuhause“ hat?
Ich kann es nicht sagen, finde keine
eindeutige Antwort.
Vielleicht spielten alle die genannten
Faktoren eine Rolle, einige mehr, andere weniger. Ich weiß nur sicher, dass mir
die Auswahl der Reiseziele und die Vorbereitungen - in den ersten Jahren gar nicht so einfach - viel
Freude bereiteten; es machte einfach Spaß, all die mannigfaltigen Möglichkeiten
zu sehen und dann alles detailliert vorzubereiten.Wenn dann das Geplante die Erwartungen
erfüllte und alles klappte, war es schon ein schönes Gefühl.
Im Internet fand ich diese Bemerkungen, die
ich in Teilen vertreten kann:
„Die
Fremde ist jener Teil der Welt, in dem wir uns nicht auskennen und uns
folglich
unsicher und angreifbar fühlen. Zu
reisen verlangt die Bereitschaft, sich einem Risiko auszusetzen, und wir tun
es, weil Fremdheit zwar bedrohlich, aber gleichzeitig verlockend ist. Nur wer
die Angst bezwingt und das Bedürfnis nach
vertrauter
Umgebung suspendiert, wird den Gewinn genießen, den wir uns vom Reisen
erhoffen. In kognitive Verwirrung zu geraten ist Teil der Erfahrung“.
- Herz -
Alle
nachfolgenden Ausführungen und Anmerkungen betreffen das Herz nur als Organ,
als physikalisches Instrument zur Versorgung des Körpers mit Blut, keineswegs
als Metapher für emotionale, ethische oder moralische Dimensionen; ob sie bei
der geschilderten Problematik auch eine Rolle gespielt haben könnten, bleibt
spekulativen Überlegungen überlassen.
Nach
den Sommerferien im Jahr 1994 spürte ich beim Lehrersport während des dem
Volleyballspiel nachfolgenden Fußballspiels Schmerzen in der linken Brustseite;
sie verschwanden nach einer kleinen Pause, meldeten sich aber bei der nächsten
Belastung zurück.
Bei
„Georg“ meinte Kollege Hartmut, ich sollte doch mal das Herz untersuchen
lassen.
Da
ich nahezu mein ganzes Leben Sport getrieben und noch nie mit diesem Organ
Probleme gehabt hatte, hegte ich einen gewissen Zweifel an seinem Rat, ließ
mich aber einige Zeit später von Dr.Schulze zu einem Kardiologen nach Heilbronn
überweisen.
Nach
der Untersuchung empfahl er mir eine Katheteruntersuchung an der Uni-Klinik
Würzburg.
Meine
damaligen ersten Erfahrungen mit dem Internet ließen mich einen Professor
Mehmel am Städtischen Krankenhaus in Karlsruhe entdecken, und er führte kurze
Zeit später die Untersuchung durch; sie ergab zwei leichtere Stenosen (78 und
81%) an der Riva.
Er
dilatierte sie, und damit war die Sache behoben.
Als
aber vier Jahre später dieselbe Symptomatik wiederum auftauchte, war ich schon
beunruhigt.
Dieses
Mal fand er an einem höheren Abschnitt der Riva eine 94%-ige Engstelle, die er
nach Dilatation mit einem Stent offenhielt.
Kurzum:
Von 1998 bis 2016 wurden in insgesamt 13 Herzkathetereingriffen immer wieder
sich bildende Stenosen dilatiert und mit Stents versorgt, so dass bis jetzt
sechs dieser Plantingebilde den Blutfluss gewährleisten.
Als
man 2007 bei einer Katheterintervention in Karlsruhe zwei über 90-zigprozentige
Verschlüsse im Hauptstamm feststellte, erklärte man mir eine Bypassoperation
als absolut notwendig; sie sei alternativlos.
Ich
hatte mir diesen doch martialischen Eingriff bereits früher im Internat
angeschaut und hatte eine panische Angst davor.
Nach
mehreren harten Diskussionen mit dem Chefarzt und seinen Oberärzten und der
Unterschrift auf einige Formulare, fuhr ich quasi einarmig mit meinem
Campingbus wieder nach Hause; der andere Arm war durch den Kathetereingriff
noch fixiert.
Als
ich dann zwei Tage später die erbetene DVD, die den gesamten Eingriff und dessen
Diagnose enthielt, in den Händen hielt, fertigte ich 10 Kopien davon an und
schickte jeweils eine an die 10 größten Kardiologiezentren in Deutschland, mit
der Bitte, mir kurz mitzuteilen, ob es zu der angeratenen Bypassoperation ihrer
Meinung nach eine alternative Behandlungsmethode gäbe.
Erstaunlicherweise
antworteten alle 10 Institute, zum Teil mit sehr detaillierten und fundierten
Ausführungen ihrer vorgeschlagenen Behandlungsweisen.
Acht
davon lehnten eine Beseitigung der Engstellen im Hauptstamm mit Hilfe eines
Katheters und Stents rundweg ab; sie hatten einen solchen Eingriff noch nie
durchgeführt und hielten seine Durchführung für zu riskant.
Nur
das Herzzentrum in Bad Krozingen und das Deutsche Herzzentrum in München
erklärten sich bereit, den Kathetereingriff am Hauptstamm durchzuführen.
Aus
persönlichen Gründen entschied ich mich für München, wo am 11.Februar 2004 die
Stenosen beseitigt wurden.
Die
Intervention dauerte weit über zwei Stunden und war sehr schmerzhaft
(normalerweise ist eine Katheteruntersuchung völlig schmerzfrei), und als nach
einer Stunde plötzlich zwei weitere Ärzte dazu gekommen waren, wurde mir klar,
dass es Komplikationen gegeben haben musste.
Nach
zwei Nächten und drei Tagen auf der Intensivstation und nach einem weiteren Tag
in einem Patientenzimmer wurde ich dienstags entlassen.
Als
ich durch die Flure und die Treppen zum Parkplatz ging, bekam ich plötzlich
starke Schmerzen im gesamten Brust-und Rückenbereich sowie in den Oberarmen.
Ich
verbrachte noch eine Nacht bei meiner Tochter Antje, und am nächsten Tag fuhren
Heidrun und ich wieder nach Sulzfeld.
Unserer
Meinung waren diese Schmerzen dem doch etwas komplizierteren Eingriff
zuzurechnen, und sicherlich würde sich alles in absehbarer Zeit da drinnen
wieder „beruhigen“.
Diese
Hoffnung trog, denn während der Fahrt und zu Hause quälten mich diese Schmerzen
massiv, und auch die hinzukommende Atemnot war sehr beängstigend, ebenso wie
die Feststellung, dass der Schmerzpegel auch in Ruhe nicht sank.
Für
mich heute unerklärlich, plagte ich mich acht Wochen in diesem Zustand zuhause
herum, ehe ich bei Dr.Pache in München anrief; ich hatte ihn nach dem Eingriff
und in dem viertägigen Aufenthalt in der Klinik nicht ein einziges Mal gesehen, und auch jetzt äußerte er sich erst nach mehrmaliger
Nachfrage zu dem Akt am 11.2.2004.
Fazit:
Er
hätte die zwei Stents im Hauptstamm doch gut platzieren können, hätte aber
gezwungenermaßen drei wichtige, benachbarte Blutgefäße „überstenten“ müssen;
ich solle doch nach München kommen, er würde versuchen, die Blockaden dieser
drei Arterien zu beseitigen und sie wieder durchlässig zu machen.
Dazu
hatte ich aber keine Lust mehr.
Die
meiste Zeit von Anfang April bis zum 8.August 2008 verbrachte ich im Bett oder
vor dem Fernseher, denn nahezu jede Anstrengung
provozierte starke Schmerzen.
An
letzterem Datum wachte ich morgens gegen vier Uhr auf; ich hatte Schmerzen im
Brustbereich und litt unter Atemnot.
Da
meine Frau in München war, rief ich den Notarzt an.
Er
wollte mich ins Krankenhaus nach Bretten bringen lassen, aber alle Krankenwagen
waren unterwegs.
Um
8.30 Uhr rief ich bei meinem Kardiologen in Bruchsal an; ich wusste, dass er
immer samstags im Städtischen Krankenhaus Karlsruhe „Katheter schob“.
Ich
schilderte ihm meinen Zustand, und zwei Stunden später informierte er mich,
dass ich am nächsten Tag um 7 Uhr in Karlsruhe sein sollte. Ich vermute, er
hatte einen weniger dringenden Fall storniert.
Gegen
7.30 Uhr verabreichte er mir das Kontrastmittel und konnte kaum glauben, was er
sah: die große Vorderwandarterie (Riva) war im oberen Segment zu 96%
verschlossen, d.h., der Großteil des Herzens konnte bei Belastung nicht mehr
ausreichend mit Blut versorgt werden; daher die Schmerzen und die Atemnot.
Zum
Glück kam er mit seinem kleinsten Katheter durch die Engstelle durch und konnte
anschließend mit im Durchmesser immer größeren Kathetern die Stenose vollkommen
beseitigen.
Bereits
in der ersten Phase der Dilatation spürte ich, wie der Druck und die Schmerzen
langsam verschwanden, und als dann der 50 mm-Stent mit 15 bar eingepresst war,
fühlte ich mich wie neu geboren.
Da
er schon immer gegen den Eingriff in München gewesen war, suchte er natürlich
jetzt Argumente gegen die Intervention am Hauptstamm in München und mutmaßte,
dass die gerade behobene Stenose daraus resultiert hatte, was ich aber nicht
glaube, denn die überstenteten Arterien sind wesentlich weiter oben.
In
den folgenden fünf Jahren konnte ich mich wieder einigermaßen bewegen
(E-Radfahren, Lehrersport, Wandern).
Da
das Problem mit den überstenteten Arterien nach wie vor vorhanden ist, wird das
Herz bei höherer Belastung nur mangelhaft versorgt und reagiert dann wie
gewohnt: mit Schmerzen, beginnend etwa bei einer Pulsfrequenz von 115/Min.
Positiv
dabei ist, dass nach die Schmerzen nach kurzer Zeit wieder verschwunden sind,
sodass ich ganz selten das Nitro-Spray verwenden muss.
Eigentlich
bestimme ich durch mein Verhalten den „Aggregatzustand“ meiner Pumpe; das ist
doch schon mal etwas.
Aus
bis heute unerfindlichen Gründen - ich hatte meine Ernährung auf die
Dr.Ornischdiät umgestellt, hatte mich in meinem Leben immer bewegt, der
„Schulstress“ war weg, genetisch war keine Veranlagung bekannt, nie geraucht
- verstopften immer wieder Kranzgefäße
am Herz. So war es auch 2013 wieder so weit: zwei Engstellen hatten sich
entwickelt, die in Karlsruhe von Dr. Ringwald beseitigt und mit zwei
beschichteten Stents stabilisiert wurden.
Drei
Jahre später lag ich erneut auf dem Tisch, um den zwölften „Kathetergang“ über
mich ergehen zu lassen.
Was
war passiert?
Nach
einem sehr guten Abendessen im Restaurant bei der Talstation der „Jochbergbahn“
oberhalb von Vals in Südtirol, bekam ich heftige Brustschmerzen und Atemnot,
die ich mit Hilfe von einigen Dosen Nitropray reduzieren konnte.
Am
nächsten Morgen fuhren wir mit unserem Campingbus auf schnellstem Weg nach
Hause, und am Montagmorgen um 7 Uhr wartete ich vor dem Operationssaal der
Uni-Klinik Heidelberg auf meine Katheteruntersuchung.
Gegen
14 Uhr teilte man mir mit, dass die Untersuchung auf den nächsten Tag
verschoben werden muss, da akute Fälle Vorrang haben.
Als
er sich dann am Dienstagmorgen knapp 30 Minuten in meiner Pumpe umgeschaut
hatte - immer wieder von seinem leisen Singsang untermalt - teilte mir
Professor Katus kurz mit, dass es zu einer Bypassoperation keine Alternative
gäbe; er würde alles Notwendige für den morgigen Eingriff veranlassen. Dann
verschwand er.
11
Jahre später war ich also wieder mit demselben Dilemma wie in Karlsruhe
konfrontiert, und erneut bedurfte es meinerseits heftigster Argumentation, um
am späten Abend den „Entlassschein“ zu bekommen; verschiedenste Ärzte hatten
sich nicht gescheut, mich mit brutalen Argumenten („Todesgefahr“) zu einer
Einwilligung zur Bypassoperation zu überreden.
Am
nächsten Tag rief ich Dr.Ringwald in Bruchsal an und schilderte ihm die
Situation.
Er
hielt eine Bypassoperation auch für das Richtige - wie 11 Jahre zuvor - bot mir
aber an, noch einmal alles zu durchdenken; wenn ich mich für eine
Katheteruntersuchung entscheiden würde, könnte er sie zwei Tage später
durchführen.
Kurz
vor 12 Uhr rief ich ihn an, und wir vereinbarten den Termin des Eingriffs auf
den 2.November.
Am
Tag zuvor (Feiertag) teilte er mir in einem kurzen Anruf mit, dass er die
Katheteruntersuchung nicht durchführen werde. Auf Fragen meinerseits reagierte
er nicht und legte auf.
Von
einem solchen Verhalten eines Arztes, zu dem ich nahezu 20 Jahre Vertrauen
gehabt hatte und dessen Arbeit ich in dieser Zeit bei allen Gelegenheiten
positiv erwähnt hatte, war ich zutiefst schockiert; ich konnte und kann bis
heute keine Gründe dafür finden.
Da
ich die Probleme ohne die Verwendung von Nitroligual nicht in den Griff bekam,
musste ich schnellstens nach Hilfe finden.
Ich
fand sie bei Professor Hennersdorf in Heilbronn.
Drei
Tage später hatte er mit drei weiteren Stents die massiven Stenosen beseitigt;
in einer nachfolgenden Intervention wollte er nach vier Wochen noch drei Stents
setzen.
Im
Januar 2017 rief ich ihn aber an, schilderte ihm meinen aktuell „brauchbaren“
Zustand und vereinbarte mit ihm, dass ich mich bei einer auftretenden
Verschlechterung sofort melden würde.
Ich
spüre in den vergangenen Wochen, dass leichte Schmerzen bereits bei weniger
Belastung auftauchen und dass auch sporadisch Rhythmusstörungen spürbar sind,
aber ich huldige mal wieder einer meiner Lieblingseigenschaften: der Kunst der Verdrängung.
- Ballreich –
Durch unsere kleine Landwirtschaft waren mir die meisten
Gewannnamen in Sulzfeld gut bekannt.
Von einem Gewann „Ballreich“ erfuhr ich zum ersten Mal, als
mir meine Frau 1971 mitteilte, dass wir die Möglichkeit hätten, in diesem Areal
einen Bauplatz zu bekommen.
Als wir dann aber zu einer Besichtigung hinausfuhren, stellte
ich fest, dass mir die Flurstücke sehr bekannt waren, denn ich war hier schon
oft mit Skiern unterwegs gewesen, und im Krieg hatten wir manchmal auf dem
Gelände Schutz vor den Fliegerangriffen gesucht; allerdings kannten wir dieses
Gewann unter dem Namen „An der Kelter“, zurückzuführen auf ein großes Sandsteingebäude, in das wir
früher eingestiegen waren, um die vielen dort hausenden Eulen zu beobachten
(während des Krieges wurden dort nachts die polnischen Zwangsarbeiter
eingesperrt).
Dieses Gewann wurde ab 1971 als Bauland erschlossen, und so
befreite ich im Frühjahr 1971 unsere 15 ar Weinberg von den Rebstöcken und
anderem Bewuchs, und mit Hilfe eines Fußballkameraden aus Mühlbach - er brachte
seinen Bagger mit - und des Vaters einer Schülerin - dieser seinen Laster -
wurde dann im Sommer die Baugrube ausgehoben.
Wir bauten* das erste Ytonghaus in Sulzfeld, dessen Erstellung
anfangs nicht ganz ohne Schwierigkeiten („I bin Mauerer, koin Kleberer“)
verlief, aber im Frühjahr 1974 konnten wir drei - unsere Tochter Antje war im
Januar 1971 geboren worden - einziehen,
nachdem meine Frau und ich seit unserer Heirat 1968 in der Gartenstraße gewohnt
hatten. Mit der Geburt von Judith im März 1982 war unsere Familie komplett, und
das Leben im „Ballreich“ nahm seinen Lauf.
Antje machte 1990 in Eppingen ihr Abitur, und nach dem
Abschluss ihres Studiums an der Universität Heidelberg (Politik, Englisch und
Sport) arbeitete sie vier Jahre in Paris.
Heute wohnt sie mit ihrem Mann Marcel Koos und ihren drei
Kindern Lasse, Milan und Finni in München. Sie unterrichtet Sport und Englisch
am „Staatlichen Gymnasium München-Nord“.
Judith machte 2001 in Eppingen ihr Abitur
und arbeitete nach einer weiteren zweijährigen Ausbildung im Hotel „Brenners“
in Baden-Baden und später in der Nähe von Schwäbisch Hall.
Sie lebt und arbeitet heute mit ihrem Mann Stefan Weiß in
Göteborg und ist gerade dabei, ihren „Master“ zu machen.
Glücklicherweise überlebte meine Frau eine schwere Erkrankung
im Sommer 1998, und wenn unser „Finale“ noch einigermaßen glimpflich verlaufen
sollte, können und werden wir uns nicht beschweren.
*Als ich den Lageplan erhalten hatte und ihn an Ort und Stelle
mit den geographischen Gegebenheiten verglich, wusste ich sofort, dass unser
Haus gemäß diesen Unterlagen nicht gebaut werden würde.
Der Hang ist exakt nach Süden ausgerichtet, die
vorgeschriebene Lage wäre aber noch Norden versetzt gewesen, sodass
Balkon, Terrasse und Wohnzimmer ab dem späteren Nachmittag
keine Sonne mehr bekommen hätten.
Als meine Anfrage von der Verwaltung nach längerer Zeit nicht
beantwortet wurde, ließ ich die Baugrube etwa um 40° nach Osten versetzt
ausheben und markierte später mit Hilfe vom Pythagoras die vier Eckpunkte des
Gebäudes.
Als bei der Bauabnahme die Unstimmigkeit bemerkt wurde,
mussten wir eine geringe Bußgebühr bezahlen, haben seither aber drei bis fünf
Stunden länger Sonne.
Schule (1946
bis 1957)
Nachdem
ich den Besuch des Kindergartens in der Hinteren Straße verweigert hatte – zwei
Stunden an einem Vormittag 1944 hatten mich davon überzeugt, dass diese
Institution nicht das Richtige für mich war – stand im April 1946 der Eintritt
in die Grundschule an.
Ihm
konnte ich nicht entkommen.
Ich
weiß noch, dass meine Mutter mich eines Tages nach dem Mittagessen etwas
„besser“ anzog und mit mir über die Luisenstraße zum Schulgebäude neben dem
„Badischen Hof“ hinüberging.
Vor
dem großen Eingangstor auf der Ostseite des Gebäudes befahl sie mir, die Treppe
hinaufzusteigen und verabschiedete sich dann, denn sie musste zu „Augustonkel“
und mit ihm und Elsa Kern hinaus zu seinen Äckern, wo Feldarbeiten auf sie
warteten. So etwas wie Einschulung bzw. irgendwelche Feierlichkeiten zu diesem
Anlass gab es damals noch nicht; man hatte Wichtigeres zu tun.
An
was erinnere ich mich noch in diesen fünf Jahren bis 1951?
Etwa
50 Kinder saßen auf den damals üblichen Schulbänken mit ihren Klappsitzen und
dem an der Oberseite eingelassenen Tintenfässern und harrten der Dinge, die die
verschiedenen Lehrer mehr oder weniger kunstvoll, engagiert, streng oder
nachsichtig vor ihren Augen zelebrierten.
Die
erste Lehrerin in meinem Leben war eine gewisse Frau März; sie kam aus
Sinsheim.
Ich
saß damals in der ersten Bank, und ich glaube, es war noch keine Stunde
vergangen, als sie mir die erste Ohrfeige gab; den Grund dafür weiß ich nicht
mehr.
Genau
erinnern kann ich mich aber noch an ihren Besuch bei uns zuhause ein halbes
Jahr später.
Meine
Mutter hatte mir einen Pullover aus brauner Wolle gestrickt, der auf der
Vorderseite mit zwei sich gegenüberstehenden Hirschen verziert war.
Dieser
Pullover hatte es ihr anscheinend angetan, denn sie wollte von meiner Mutter
wissen, wie sie ihn angefertigt hatte; möglicherweise hatte sie eigene Kinder.
Die
nächsten vier Jahre verbrachte ich unter dem Zepter von Herrn Englert.
Er
war ein etwa 50-jähriger Mann, der sehr spät und nicht ohne Folgen aus dem
Krieg zurückgekommen war.
Er
saß meistens hinter seinem erhöhten Katheder und knabberte an seinen
Fingernägeln herum; sie waren beinahe bis zur Nagelmitte abgebissen.
Wie
er uns – zumindest den meisten – Lesen, Schreiben, Rechnen und andere Dinge
beigebracht hat, weiß ich nicht mehr.
Andere
Lehrer an der Schule waren Herr Eckert und Herr Friedmann.
Während
letzterer sehr streng, aber einigermaßen gerecht war, war das Markenzeichen des
ersteren brutales Prügeln und Erniedrigen von Kindern.
Meine
Nebensitzer waren Peter Pottiez, Sohn der reichsten Familie in Sulzfeld, und
Hans Hagenbucher. Dessen erste Handlung morgens war, das doch etwas
umfangreichere Vesper aus seinem Schulranzen zu nehmen und auf der Fensterbank
zu stapeln.
Die
Winter damals waren oft sehr schneereich und bitterkalt, sodass wir manchmal
zuhause bleiben konnten, weil nicht genügend Kohlen für den neben der Tafel
stehenden Ofen zur Verfügung standen.
Um
unsere Schiefertafeln zu reinigen, kratzten wir oft das sich an den
Außenfenstern der Schule angesammelte Moos ab.
An
manchen Tagen mussten wir übelriechenden Lebertran einnehmen; der größte Teil
davon landete oft in den Tintenfässchen.
An
irgendwelche Unternehmungen außerhalb der Schule, Wanderungen oder
Naturerkundungen kann ich mich nicht erinnern, abgesehen von einer Aktion:
1948
und 1949 stiefelten wir – mit Eimern bewaffnet - in die Wälder und mussten
Maikäfer einsammeln.
Bereits
zu Beginn der 4.Klasse fiel zuhause immer mal wieder das Wort „Gymnasium“, und
in der zweiten Schuljahrshälfte gab Frieda keine Ruhe mehr und setzte mir immer
stärker zu.
Ich
kann aus heutiger Sicht über die Gründe nur spekulieren, die mich davon
abhielten, dem Wunsch meiner Mutter zuzustimmen.
Ausschlaggebend
war, so denke ich, einfach mein mangelndes Selbstbewusstsein, das sich wie ein
roter Faden durch mein ganzes Leben zog, auch wenn es für viele nicht so den
Anschein hatte und hat.
Woraus
hätte es resultieren können?
Ich
hatte bereits früh festgestellt, dass Menschen alles andere als gleich waren.
Es
gab schöne und hässliche Menschen und vor allem: es gab arme und reiche
Menschen.
1950
umfasste unsere Familie sechs Mitglieder: meine Eltern und wir vier Kinder.
Erstere
mussten beide hart arbeiten, damit wir mehr schlecht als recht über die Runden
kamen.
Wir
wohnten auf engem Raum in einer schlicht möblierten Wohnung.
Daneben
sah ich die andere Welt, denn mit 10 Jahren freundete ich mich mit einem
Nachbarjungen an (evtl. auch er mit mir) und war oft bei ihm zuhause.
Ich
war mit Erich Velten, dessen Großvater die Möbelschreinerei Friedrich mit ihrer
großen Werkstatt gehörte und der mit seiner Mutter und seiner Schwester in
einem pompösen Haus bei seinen Großeltern wohnte, eng befreundet und besuchte
ihn sehr oft.
Ich
fühlte mich nie sehr wohl in diesem Haus, was aber nur an mir lag, denn Lotte,
Erichs Mutter, tat alles, dass ich mich der Familie hätte zugehörig fühlen
können.
Ich
habe mich später oft mit Lügen vor Einladungen gedrückt, denn auf der Straße
fühlte ich mich wohler.
Obwohl
Erich nie mit uns herumtobte und ganz selten das große Haus verließ, waren wir
nahezu jeden Tag für Stunden zusammen, meistens bei ihm in seinem Zimmer, wo
wir in seinem Bett gemeinsam „Tarzan“ lasen (1961 machten wir zusammen das
Abitur).
Ich
dachte einfach, dass ich bei einem Wechsel auf das Gymnasium erst recht mit
dieser „Welt der Reichen“ konfrontiert werden würde und ihr nicht so leicht
entfliehen könnte.
Zu
meiner Unsicherheit und Labilität trug auch meine krumme Nase bei, die ich seit
Mitte 1950 mit mir herumtrug.
Kurzum:
Ich
widersetzte mich in der vierten Klasse mit aller Macht dem Wunsch und dem
Befehl meiner Mutter zu einem Wechsel ins Progymnasium nach Eppingen; ich
setzte mich auch durch, stand aber ein Jahr später wieder vor demselben
Dilemma.
Im
März 1951 waren wir bei Belschners bei einer Hausschlachtung, als der
Briefträger meine Mutter erkannte und mir einen Brief hinhielt, den ich ihr
geben sollte, denn dann könnte er sich den Weg auf die Bäreninsel ersparen.
Ich
bemerkte sofort das Wort „Progymnasium“ und steckte ihn ein.
In
der Scheune öffnete ich ihn und konnte dem Inhalt entnehmen, dass wir ein paar
Tage später zur Anmeldung nach Eppingen kommen sollten.
Sie
hatte mich also ohne meine Zustimmung angemeldet, hatte mich nicht einmal
gefragt.
Voller
Wut zerriss ich den Brief und rannte durch die Gärten und am Kohlbach entlang
hinaus zum „Badhäusle“.
Dort
trieb ich mich den ganzen Tag herum, bis ich ja abends wieder nach Hause
musste.
Eine
Woche später stand ich wartend mir ihr vor dem Rektorat im Schulgebäude in der
Kaiserstraße in Eppingen, zusammen mit etwa einem Dutzend weiteren Aspiranten
mit ihren Müttern.
Da
unser Lehrer Englert es trotz aller Bemühungen nicht geschafft hatte, uns
wesentlich mehr als die Grundkenntnisse des
Lesens,
Schreibens und Rechnens beizubringen, hatte ich noch eine Chance, dem
Progymnasium zu entrinnen: wenn ich die obligatorische Aufnahmeprüfung nicht
bestehen würde, hätte sich die Sache von alleine erledigt.
Diese
Chance war gar nicht so gering, denn die Durchfallquote war hoch.
Wie
sich später herausstellen sollte, hing mein Schicksal an vier mündlichen
Mathematik aufgaben.
Das
Diktat und der geforderte Aufsatz stellten keine Probleme für mich dar – ich
hatte ab der 3.Klasse alles gelesen, was ich erwischen konnte – aber von der
überwiegenden Anzahl der bei den Mathematikaufgaben verwendeten Begriffe
(Divisor, Addition, Multiplikation, etc.) hatte uns Herr Englert nichts erzählt.
Keine
der gestellten Mathematikaufgaben hatte ich richtig gelöst.
Da
aber das Ergebnis der Deutschprüfung in gewisser Weise darauf schließen ließ,
dass der Kandidat doch nicht so ganz dumm sein könnte, gab man mir mit einer
mündlichen Mathematikprüfung noch eine Chance.
In
diesen fünf Minuten hätte ich selber entscheiden können, wohin mein Lebensweg
gehen würde, aber anscheinend können die größten Aversionen gegen eine
Schulform nicht bewirken, dass ein Zehnjähriger sich absichtlich und gewollt
blamiert und bloßstellt.
Ergebnis:
Ab April 1951 war ich Schüler des Progymnasiums
Eppingen.*
„Alea iacta est“!
Unter
dem Dach des Sandsteingebäudes in der Kaiserstraße in Eppingen versuchten sie,
dem sich innerlich immer noch Sträubenden in den nächsten sechs Jahren
wenigstens die Grundlagen des deutschen Kulturgutes beizubringen.
|
|
Sie?
Namen
wie Siegel, Türck, Keiler, März, Bauer, Eger, Konrad, Eisenlohr und Häusermann
fallen mir noch ein.
Wie
bei Menschen allgemein – und bei Lehrern im Speziellen – prägen Erinnerungen
der unterschiedlichsten Facetten und Nuancen das Bild der Betreffenden, und man
könnte seitenweise Episoden und Begebenheiten wiedergeben.
Lassen
wir das; für manche/n ist es besser so.
Meine
Klassenkameradinnen und Klassenkameraden kamen aus allen sozialen Schichten aus
Eppingen und den Dörfern der Umgebung, so dass sich meine Befürchtungen bald in
Luft ausgelöst hatten.
Während
in der Sexta noch 35 Kinder das Klassenzimmer füllten, war die Schülerzahl ab
der Quarta doch schon stark dezimiert, und 1957 verließen 23 Mädchen und Jungen
mit der „Mittleren Reife“ in der Tasche das Progymnasium.
Um
das Abitur zu erlangen, musste man sich für eines der Gymnasien in Bretten oder
Sinsheim entscheiden.
Der
Zusammenhalt und die Atmosphäre in unserer Klasse waren sehr gut gewesen, was auch zu einem
großen Teil unserem Klassenlehrer Karl Türck zu verdanken war; er streifte
immer wieder mit uns durch den Kraichgau - fuhr mit uns auch mal nach
Heidelberg und Karlsruhe - verließ oft die eigentlich obligatorischen
Unterrichtsthemen und verpasste keine
Gelegenheit, uns mit seinen
„Lebensweisheiten“ und spaßigen Bemerkungen zu erheitern; als ebenso
positiv auf unsere Klassengemeinschaft erwiesen sich die immer wieder in Elses
„Ahnenkeller“ stattfindenden „Meetings“.
Diese
sechs Jahre im Progymnasium Eppingen empfinde ich heute noch als eine sehr
positiv und harmonisch verlaufene Phase meines Lebens; die Beziehung unter uns
Kindern hätte nicht besser sein können. Dies zeigt sich auch heute noch bei den
gelegentlichen Zusammenkünften.
*=
Es ist sicher müßig und auch albern, sich die Frage zustelle, was wäre gewesen,
wenn.......
In
meinem Fall: Abitur oder Beruf.
Mein
Interesse galt Autos, Motorrädern und Technik.
Es
wäre denkbar gewesen, dass ich es in diesen Bereichen „zu etwas gebracht“
hätte, auch ohne eigenes Kapital. Die Chancen waren 1956 und danach riesig:
Alles wuchs, breitete sich aus und gedieh.
Das
Wirtschaftswunder lauerte in den Startlöchern, Scheitern war nahezu unmöglich.
War
es „gut“, dass ich die vier Aufgaben richtig beantwortet hatte?
Ganz
abgesehen davon, dass es keine andere Möglichkeit gab: die eindeutige Antwort
ist „ja“.
Ich
habe in den 37 Jahren als Lehrer Positives und Negatives erlebt, wobei ersteres
eindeutig überwog.
Dass
zu diesem interessanten und abwechslungsreichen Beruf eine zusammen mit meiner
Frau erwirtschaftete völlig ausreichende und befriedigende Prosperität kam, ist
sicher - auch - ein Beweis für mein richtiges Verhalten in der damaligen mündlichen
Mathematikprüfung.
- Schule
(1957 bis 1961) -
Diese
positive und angenehme Atmosphäre traf ich in Bretten nicht an, weder in der
neuen Klasse – Obersekunda – noch in der gesamten Schule.
Ich
fühlte mich von Anfang an unwohl in meiner neuen Umgebung, so dass im Laufe des
ersten Schuljahres am Melanchthongymnasium in Bretten meine alten Aversionen
und Widerstände wieder aufbrachen.
Alles
war überdimensioniert:
Die
Schule, die Klasse, der Schulweg.
Mehr
als 40 Jugendliche umfasste die Obersekunda, der Unterricht verlief wie an der
Uni:
Vorne
stand eine/r, dozierte oder schrieb die Tafel voll, und nach dem Klingelzeichen
verschwand sie/er.
Als
Menschen wurden wir von den meisten nicht wahrgenommen (die einzige Ausnahme
war Herr Männle).
Genauso
minimal waren auch die persönlichen Kontakte innerhalb der Klasse.
Außer
zu Herbert Kritter aus Bretten und Helmut Schuster aus Oberderdingen hatte ich
keine Beziehung zu der Klasse.
Auch
der Schulweg war frustrierend:
Ob
man den Dampfzug aus Sulzfeld am Brettener Bahnhof oder bereits in Gölshausen
verließ: zu den 35 Minuten Zugfahrt kamen noch einmal 40 Minuten dazu, bei
Sonne, Regen oder Schnee.
Neben
der Schule hatte sich Weiteres geändert:
Ich
war viel außer Haus und unterwegs.
Seit
1956 hatte ich ein Moped („Quickly“), mit dem ich ständig durch
die Gegend fuhr (1957 sogar durch den Schwarzwald zum Bodensee), und seit 1955
spielte ich Fußball, welcher eine immer größere Rolle in meinem Leben einnahm
(mit all seinen positiven und negativen Auswirkungen). Schule wurde immer mehr
zur Last.
Möglicherweise
dienen mir all diese Faktoren nur als Vorwand für das, was zwangsläufig
eintreten musste; dass es mich aber in einer Sprache (Französisch) erwischen
würde, hätte ich nicht gedacht; wenn schon, dann war immer Mathematik mein
Favorit gewesen.
Heute
egal, auf jeden Fall übernahm ein gewisser Lehrer Kleinheinz („Joe“) die Rolle
des Vollstreckers.
Er
muss krank gewesen sein und hätte nie unterrichten dürfen, und da ich einer der
wenigen war, die auf seine vermeintlichen Geistesblitze nicht mit Lachen
reagierte, hatte er mich schon lange auf dem Kieker.
Im
Dezember 1957 hatte ich zusammen mit Herbert Kritter das Länderspiel der
deutschen Fußballnationalmannschaft im Niedersachsenstadion in Hannover
besucht.
Wir
hatten uns dafür einen Tag „freigenommen“ und kamen zwei Tage später erst gegen
Morgen wieder aus Hannover zurück.
Nach
einem kurzen Frühstück bei „Herles“ Mutter kamen wir ziemlich geschafft in die
Schule.
„Joe“
muss das aufgefallen sein, oder er hatte den Grund unseres Fehlens
herausgefunden, denn plötzlich legte er zwei leere Blätter vor uns auf den
Tisch und verlangte eine Zusammenfassung der am Vortag begonnenen Lektion.
Höhnisch
grinsend nahm er am Ende der Stunde die leeren Blätter entgegen.
Diese
„Sechs“ gab dann den Ausschlag.
Ich
unterschlug noch zwei Briefe, in denen meine Mutter zu einer Vorsprache in der
Schule aufgefordert wurde, aber am letzten Schultag vor Beginn der Osterferien
hatte ich es schriftlich in den Händen: Sitzenbleiber.
Ich
konnte ihr diese Tatsache nicht verschweigen, zeigte ihr aber das Zeugnis in
Anwesenheit von Tante Rosa und Onkel Konrad, die damals gerade aus Biberach zu
Besuch gekommen waren; möglicherweise trug deren Anwesenheit dazu bei, dass
ihre Reaktion etwas verhaltener ausfiel.
Für
mich stand eines fest: niemals mehr Schule!
Dieser
Entschluss bewog mich, nach Ostern verschiedene Firmen aufzusuchen und mich
nach Arbeitsplätzen zu erkundigen.
Bei
der E.G.O. in Oberderdingen unterschrieb ich dann einen Ausbildungsvertrag zum
Großhandelskaufmann, dessen Inkrafttreten aber noch von der Unterschrift meiner
Eltern abhing.
Die
Gründe, warum ich dann während der Osterfeiertagen im Arbeitsamt Karlsruhe
telefonisch einen Gesprächstermin vereinbarte, sind mir heute nicht mehr
bekannt.
Tatsache
ist aber, dass der Besuch in Karlsruhe alles änderte.
Ich
weiß noch, dass mir in dem kleinen Büro ein älterer Mann gegenübersaß, mir
zunächst ruhig zuhörte und dann durch gezielte Fragen mehr von mir, meiner
Situation, meinem Umfeld und meinen Vorstellungen herausfinden wollte.
Wie
er es letztendlich geschafft hatte, meinen Widerwillen gegen alles, was mit
Schule zu tun hatte, zu beseitigen bzw. zu reduzieren und mich dazu zu bewegen,
doch noch das Abitur anzustreben, weiß ich heute im Einzelnen nicht mehr.
Das
Ergebnis seiner Bemühungen war jedenfalls, dass ich auf der Rückfahrt von
Karlsruhe in Bretten ausstieg, den weiten Weg zum Melanchthongymnasium
hinauflief und mich für die Obersekunda anmelden wollte.
Leider
hatte ich meiner „Begeisterung“ vergessen, dass Schulen in den Ferien im
Allgemeinen geschlossen sind.
Dieser
Umstand konnte aber den Neubeginn nach Ende der Osterferien 1958 nicht
verhindern.
Und
es wurde ein Neubeginn, in jeder Hinsicht.
Ausschlaggebend
war vor allem die Klasse.
Sie
war wesentlich kleiner – ich denke, sie umfasste knapp 20 Jugendliche – und ich
hatte von Anfang an das Gefühl, wieder in meiner Klasse im Progymnasium in
Eppingen zu sein.
Meine
Ängste und Befürchtungen zerrannen wie Schnee in der Frühlingssonne, und ich
war in kürzester Zeit voll in der Klassengemeinschaft integriert.
Viele
abwechslungsreiche und interessante Aktivitäten – auch auf privater Ebene –
prägten diese drei Jahre bis zum Abitur 1961; nicht zuletzt trug das
verständnisvolle und engagierte Verhalten unseres Klassenlehrers, Herrn
Brandes, zu diesem positiven Gesamtbild bei.
Nachdenklich
dabei: Welche Zufälle, Kleinigkeiten und Situationen doch einen Lebensweg
beeinflussen und mitbestimmen können.
- Studium -
Mit einem Notendurchschnitt von 2,8 wären
heutzutage die Studien-Chancen doch etwas eingeschränkt; 1961 bedeutete es
„besseres Mittelmaß“, und für meine doch nicht übermäßigen Bemühungen konnte
ich mich nicht beklagen.
Ich war mit meinem Abitur zufrieden, hatte
ich doch erst in der letzten Phase meine Hobbys zugunsten der Lernerei etwas
reduziert.
Abitur – ok, aber was jetzt?
Ich hatte mir vor dem Abitur wegen einer
Berufs-bzw. Studienwahl noch keinerlei Gedanken gemacht, da ich fest mit einer
Einberufung zur Bundeswehr gerechnet hatte, vor allem, als mir dann auch im
März 1961 der Termin zur Musterung mitgeteilt wurde.
Wenige Tage vor diesem Termin beschloss der
Bundestag in Bonn, dass „männliche Nachkommen“ der im 2.Weltkrieg gefallenen
Soldaten vom Wehrdienst befreit sind.
Ich weiß heute nicht mehr, ob ich damals
froh oder unglücklich war, als ich diesen „Befreiungsschein“ kurze Zeit später
in den Händen hielt, auf jeden Fall war damit eine völlig neue Situation
eingetreten: was tue ich jetzt? Wo soll`s langgehen?
Ich hatte mir noch nie Gedanken wegen
meiner Zukunft bzw. einer Berufswahl gemacht.
Wer oder was letzten Endes den Ausschlag
zum Lehrerstudium gab, ist mir heute nicht mehr klar.
Gab die Tatsache, dass drei meiner Freunde
sich zum Lehrerberuf entschlossen hatten, den Ausschlag, oder hatte „sie“ mit
ihrer jahrelangen subtilen Beeinflussung und Strategie doch noch ihr Ziel
erreicht?
Ich weiß es einfach nicht.
Ich kann mich nur noch erinnern, dass diese
Berufsfindungsphase meinerseits durch eine massive Unsicherheit und starke
Zweifel geprägt waren, verursacht durch mangelndes Selbstbewusstsein und –
immer noch und immer wieder – durch eine krumme Nase.
Trotz dieser wankenden Einstellungen zu
meinem zukünftigen Beruf meldete ich mich am Pädagogischen Institut in der
Bismarckstraße 10 in Karlsruhe an und begann am 2.Mai 1961 – zusammen mit etwa
200 weiteren Kommilitoninnen und Kommilitonen – mein auf vier Semester
angelegtes Pädagogikstudium.
Ich fuhr also morgens am 2.5.61 um 6 Uhr
mit dem Dampfzug nach Karlsruhe und ging dann zu Fuß etwa 40 Minuten zur
Bismarckstraße.
Nach der Anmeldung trafen sich alle
Aspiranten um 10 Uhr im großen Hörsaal, wo sie dann detaillierte Infos über ihr
Studium erhielten.
Ich weiß noch heute, welches Gefühl mich
beherrschte und dominierend präsent war:
Hier gehöre ich nicht hin. Das ist nicht
überschaubar für mich; ich will wieder in meine kleine „Bäreninsel“.
Es muss eine Form von Panik gewesen sein,
die mich in diesem Saal ergriffen hatte, denn gegen 13 Uhr ging ich zum Bahnhof
und fuhr wieder nach Hause.
Zufällig traf ich im Zug einen Nachbarn und
Schulfreund, der seit einem Jahr am PI studierte.
Es war Gerhard Schaden, der ein paar Häuser
entfernt von mir wohnte.
Er und sein älterer Bruder Hans waren mit
ihren Eltern als Flüchtlinge nach Sulzfeld gekommen.
Sie waren oft bei uns zu Hause und
schätzten die Leckereien meiner Mutter sehr.
In Bretten waren Gerhard und ich zwei Jahre
zusammen in einer Klasse; durch meinen „Blackout“ in der Obersekunda wurden wir
aber getrennt.
Während der zweistündigen Zugfahrt nach
Sulzfeld beruhigte er mich und empfahl mir, einfach doch etwas abzuwarten.
Was ich auch tat.
Ich fuhr als am nächsten Tag wieder nach
Karlsruhe und erlebte meine ersten Vorlesungen und Seminare.
Im Laufe der nächsten Wochen hellte sich
alles auf, denn ich lernte einige Menschen kennen, die mich verstanden und mir
halfen.
Da ich immer öfter – je nach Vorlesungsplan
– spät nach Hause kam, mieteten wir in der Wilhelmstraße ein Zimmer.
Es war im 4.Stock, hatte kein fließendes
Wasser, war im Sommer brütend heiß und im Winter lausig kalt, kostete aber auch
nur 20 Mark im Monat.
Ich glaube, ich habe in den zwei Jahren
keine fünfmal darin übernachtet.
Im Nachhinein kann ich eines feststellen:
Im Vergleich zu einem heutigen Studium –
egal, welcher Art – waren es zwei entspannte, lockere und abwechslungsreiche
Jahre.
Als wir vier nach einiger Zeit wussten, wie
„der Hase so läuft“ am PI – ein Jahr später mutierte es zur Pädagogischen
Hochschule (PH) – verschwanden wir morgens oft in „Auerbachs Keller“ und spielten
stundenlang Skat.
Anfangs besuchten wir noch sporadisch
manche Vorlesung, strichen aber dann auch diesen Punkt, da uns findige und
fleißige Kommilitonen mit allen Unterlagen versorgten.
In den Seminaren attestierten wir uns
manchmal gegenseitig den Besuch derselben.
Unterbrochen wurde dieses entspannte Leben
nur einmal:
Im Januar 1962 hatte man mich zu einem
sechswöchigen Praktikum in den Schwarzwald beordert, in eine kleine "Gesamtschule“ in Freiamt-Brettental, etwa 15 km nordöstlich von Emmendingen.
Mit dem Zug fuhr ich nach Emmendingen und
dann mit dem Bus hinauf nach Freiamt; die letzten 3 km zu Fuß nach Brettental
hinauf merkte ich, welches Gewicht mein Koffer doch hatte.
Es war bitterkalt, und die Schneehöhe
dürfte bei knapp 1 Meter gewesen sein.
Ich stand dann vor einem Sägewerk, zwei
Gasthäusern, einem Schulhaus und drei oder vier Wohnhäusern; auf den
umliegenden Bergen waren einzelne Bauernhöfe sichtbar.
Lehrer Brunsch war alles andere als
erfreut, als er mich an seiner Wohnungstür im Schulhaus empfing; ich vermutete,
er empfand mich als „Störenfried“ in seiner Idylle, hatte aber
erfreulicherweise in einem der gegenüberliegenden Gasthäuser bereits nach einem
Zimmer für mich nachgefragt.
Als mich dann wenig später die Wirtin des
Gasthauses „Zur Mühle“ in das für mich vorgesehene Zimmer führte, dachte ich,
mich trifft der Schlag: das Fenster war dick mit Eisblumen bedeckt, und im
Zimmer war es eisig kalt.
Sie murmelte etwas von „eingefroren“ und
verschwand.
Ich ging wieder hinunter und setzte mich an
den molligen Kachelofen.
Sie brachte mir etwas zu essen und zu
trinken und ließ dann durchblicken, dass sie nichts dagegen hätte, wenn ich
diese Nacht am Kachelofen verbringen würde.
Als gegen 21 Uhr die zwei letzten Gäste die
Gaststube verließen, nahm ich meine Bettdecke und das Kopfkissen und legte mich
auf den Kachelofen.
Bis auf wenige Male war dies mein
Schlafplatz in den vier Wochen in Brettental.
Von Herrn Brunsch habe ich viel gelernt.
Er unterrichtete die zwölf Kinder den
Klassen fünf bis acht, alle gemeinsam in einem Raum.
Die ersten Tage saß ich im Hintergrund des
Klassenraums und beobachtete das Geschehen vor mir.
Meine Aufgaben beschränkten sich in dieser
Zeit auf das Bereitstellen von Holz und das morgendliche Anzünden des großen
Ofens im Klassenzimmer.
Zu Beginn der zweiten Woche ließ er mir die
Wahl zwischen einigen Unterrichtsprojekten, die im laufenden Schuljahr noch
anstanden.
Ich entschied mich für Geografie und
speziell für das Thema „Bodensee“.
Nach zwei Wochen war ich überrascht, welche
Fülle dieses doch einfache Thema an Ergebnissen und Erkenntnissen brachte.
Es waren fruchtbare und für mich
erkenntnisreiche sechs Wochen in einer heute unvorstellbaren pädagogischen
„Idylle“.
Der heute dominierende und oft übermächtige
Begriff „Disziplin“ war nicht existent, hatte keinerlei Bedeutung. Es gab
einfach keinen Anlass, ihn zu bemühen.
Anmerkung:
Mit meinem „Busle“ bin ich schon einige Male nach Brettental gefahren und habe
neben dem Schulhaus übernachtet. Dabei habe ich erfahren, dass Herr Brunsch in
Freiburg lebt und oft nach Brettental zum Wandern kommt.
Januar und Februar 1963 schwitzten wir vier
dann über unseren Klausurarbeiten.
Als wir im Februar 1963 dann die ersten
Ergebnisse erhielten und nahezu alle mit „mangelhaft“ oder schlechter zensiert
waren, rechneten wir mit dem Schlimmsten.
So kam es dann auch, nur nicht für mich.
Wider Erwarten und zu meinem großen
Erstaunen bestand ich das Erste Staatsexamen; meine drei Kumpel mussten in die
„Strafrunde“ (ein Jahr später waren auch sie alle Lehrer).
Was hatte mich „gerettet“?
Die Zensuren für meine Zulassungsarbeit
(1,6) und meine Lehrbefähigung (1,5).
Da sie bei der Gesamtbewertung 3fach
gewichtet wurden, schufen sie den notwendigen Ausgleich zu den vielen
„mangelhaft“ in den anderen Fächern.
Ich war also Lehrer.
Basta.
Trotz krummer Nase und Unsicherheit.
Trotzdem paradox:
Jemand, für den der Begriff
"Schule" überwiegend mit negativen Attributen behaftet war, wollte
den Großteil seines weiteren Lebens dieser Institution widmen.
Egal, jetzt war nichts mehr zu machen.
Doch, ich machte noch etwas.
Ich war bei unserem Abschiedstreffen in
„Auerbachs Keller“ schon etwas „benebelt“, als ich Siegfried Kreiners Drängen
nicht länger widerstehen konnte/wollte und die Teilnahmebestätigung an einer
zweiwöchigen Skifreizeit in Adelboden unterschrieb.
Es wurden zwei sehr schöne Wochen.
- Baiersbronn -
Als ich aus der Schweiz zurückkam, lag der
„Stellungsbefehl“ bereits vor, und so fuhr ich am 22.April 1963 – es war ein
sonniger Montag – mit meinem kleinen BMW „Luxus“ früh am Morgen über Mühlacker,
Pforzheim und Besenfeld hinauf nach Freudenstadt.
Um 10 Uhr trafen sich fünf angehende
Pädagogen – darunter auch zwei Bekannte aus Karlsruhe – zur Vereidigung im
Staatlichen Schulamt.
Zu was ich dort „ja“ sagte, weiß ich heute
noch nicht, anscheinend war es einfach notwendig gewesen.
Der mir zugewiesene Dienstort war
Baiersbronn; er war mir nicht bekannt.
Auf meiner Straßenkarte suchte ich den Weg
und fuhr die 6 km in das – wie es sich bald herausstellen sollte – schmucke und
reizvolle Schwarzwaldstädtchen hinunter.
Rektor Dr.Stäbler hatte mich schon erwartet
und alles vorbereitet:
den Stundenplan, ein leeres liniertes
DIN-A4-Heft, ein Holzlineal, einen Radiergummi und einen gespitzten Bleistift;
dazu den geeigneten Bleispitzer.
Mein Dienst sollte am nächsten Tag um acht
Uhr beginnen.
Die Sache mit den Utensilien kam mir etwas
eigenartig vor, seine weiteren Ausführungen und Erläuterungen empfand ich aber
als angebracht und sinnvoll.
Als er zum Schluss ganz nebenbei erwähnte,
dass die 1.Klasse 32 Schüler umfasste, dachte ich zuerst, ich müsste mich
verhört haben.
Auf meine Nachfrage bestätigte er aber,
dass ich am nächsten Tag eine 1.Klasse zu übernehmen hätte.
Um meinen Schrecken – und etwas später
meine Empörung – zu verstehen, muss man wissen, dass mein ganzes Studium auf
die Oberstufe der Hauptschule konzentriert war.
Alle meine Unterrichtsversuche und
Lehrproben fanden in siebten oder achten Klassen statt, nur die
Prüfungslehrprobe hatte ich in einer ersten Klasse absolviert.
Didaktische und methodische Inhalte, die
ich mir angeeignet hatte, bezogen sich nur auf Fächer der Oberstufe.
Ich erläuterte ihm alle diese Umstände und
bat ihn, mir eine andere Klasse zuzuteilen, was er in einem sicher während
seiner Wehrmachtszeit angeeigneten Offizierston strikt ablehnte.
Als um zwölf Uhr die Schulglocke ertönte,
erhob er sich und verließ den Raum.
Ich setzte mich in mein Auto und fuhr
wieder nach Freudenstadt hinauf, wo ich den Schulrat noch antraf.
Er hatte mehr Verständnis für meine
Situation und wollte am Nachmittag mit Dr.Stäbler sprechen; ich sollte um 14
Uhr wieder in der Schule sein.
Als ich dann Stäblers Gesicht sah, war mir
alles klar.
Ich fragte ihn noch, ob er mir wenigstens
bei der Zimmersuche helfen oder einen Rat geben könnte, aber verwies mich nur
auf das Rathaus.
Da ich seit der Abfahrt von zuhause nichts
mehr gegessen hatte, ging ich ein kleines Café, und die Bedienung kam nach
einiger Zeit mit einem Zettel, auf dem sie zwei potentielle Vermieter notiert
hatte.
Gegen 18 Uhr bezog ich dann ein kleines
Zimmer im Reuteweg, etwa 2 km außerhalb von Baiersbronn in Richtung
Freudenstadt.
Frau Mahler war eine sympathische Frau und
wollte 20 DM im Monat.
Obwohl ich eine der von meiner Mutter
eingepackten Rotweinflaschen leerte, fand ich kaum Schlaf in dieser Nacht; ich
konnte mir einfach nicht vorstellen, was mich am nächsten Tag erwarten würde
und wie ich alles bewerkstelligen sollte.
An Details kann ich mich nicht mehr
erinnern, nur, dass das Klas- senzimmer gefüllt war mit Kindern, Eltern und
Großeltern und dass ich am Pult stand und etwas sagte.
Was, weiß ich nicht mehr, auch nicht, ob
ich dann die Erwachsenen hinausgeschickt habe oder wie lange die Kinder
geblieben sind.
Drei Tage vor Beginn der Sommerferien 1963
wurde ich krank; die Mandeln mussten raus.
Im Krankenhaus in Karlsruhe bekam ich dann
einen erstaunlichen Brief der Kollegin Schulze; sie hatte die Klasse noch die
drei restlichen Tage betreut.
Sie drückte darin ihre Verwunderung über
ihre Feststellung aus, dass alle Kinder bis auf einen Jungen lesen und
schreiben konnten.
Ich wusste, dass die Kinder ab Mitte Juli
unbekannte Wörter und Sätze lesen konnten, hatte aber keine Ahnung bzw.
Erfahrung, dass die Erlangung dieser Fähigkeit im Zeitraum von 3 Monaten
ungewöhnlich sei.
Über den Weg und die Methode zu diesem
Leistungsstand möchte ich mich hier nicht auslassen, denn es würden sich sicher
manchem Grundschuldidaktiker die Haare sträuben.
Aber was hätte ich machen sollen?
Die PH war weit weg und geeignete Literatur
gab es an der Schule nicht.
Also bastelte ich mir mein eigenes
Lernsystem zusammen, sicher beeinflusst von den Methoden, wie ich selbst Lesen
und Schreiben gelernt hatte.
Dass dieses System erfolgreich war, war zum
größten Teil der heute unvorstellbaren Disziplin und Geduld der Kinder
geschuldet.
Wir zerlegten stundenlang Silben, Wörter
und später ganze Sätze und bauten sie dann wieder zusammen - akustisch und
optisch, immer wieder aufgelockert und unterbrochen von Spielen und Liedern.
Was mich heute noch aufregt:
Weder dieser "Eisschrank" Stäbler
noch irgendein Schulrat aus dem 6 km entfernten Freudenstadt ließen sich ein
einziges Mal bei mir blicken oder erkundigten sich danach, was ich jeden Tag so
trieb, und das, obwohl sie alle wussten, wie fremd mir diese Stufe mit ihren
Anforderungen war.
Wie dem auch sei, nach den Sommerferien
wurden die Kinder immer besser und sicherer, so dass ich im September manchmal
Vorlesewettbewerbe veranstaltete, an denen sie begeistert teilnahmen.
In der Zwischenzeit hatte sich auch ein
umfangreicher Fundus an Sprach- und Rechenkärtchen angesammelt, so dass ich
nicht mehr jeden Nachmittag Stunden mit deren Herstellung verbringen musste.
Durch die so gewonnene Freizeit entdeckte
ich erst jetzt, in welchem schönen Flecken ich hier gelandet war.
Im September und Oktober erwanderte ich die
herrliche Umgebung von Baiersbronn, Mittel-und Obertal.
Am Mittwochnachmittag fuhr ich meistens
nach Tonbach in die damals noch urige "Traube" zum Kurkonzert; der
Freitagabend war dem Faustball in der Schwarzwaldhalle vorbehalten.
In den ersten Dezembertagen 1963 brach ein
Winter an, den die Leute lange nicht vergessen sollten.
Bis weit in den März lag der Schnee
teilweise meterhoch, und es war bitterkalt.
Dass meine Pendelfahrten nach Sulzfeld
übers Wochenende schadenfrei verliefen, kommt mir heute noch wie ein Wunder
vor, vor allem, weil mein „BMWle“ nur mit Sommerreifen ausgerüstet war.
Nach den Weihnachtsferien war die Schule
noch einmal für zwei Wochen geschlossen, denn in Baiersbronn wurden die
Nordischen Skimeisterschaften ausgetragen; sie umfassten Langläufe und
Skispringen. Letzteres wurde auf der Alexanderschanze am Ruhestein ausgetragen.
Auf dem Bewertungsturm neben der Schanze
hatte ich zwei Tage lang meinen "Arbeitsplatz": ich musste die
Bewertungszettel der fünf Sprungrichter einsammeln, die niedrigste und höchste
Zahl streichen und aus den drei restlichen den Durchschnitt ermitteln. Ein
Taschenrechner wäre dabei sehr hilfreich gewesen; den gab es damals aber leider
noch nicht.
Für zwei Wochen zusätzlichen Ferien
trotzdem eine erträgliche Arbeit!
Der Star dieser Veranstaltung war natürlich
Georg Thoma, der Olympiasieger von 1960 in Squaw Valley.
Es lief also alles bestens für mich in
Baiersbronn, ich fühlte mich wohl dort und hatte mich eingelebt- und trotzdem
reichte ich Mitte März meinen Versetzungsantrag ein; was mich letztendlich dazu
bewogen hatte, weiß ich nicht mehr.
Seit
ich mich meinem Campingbus unterwegs bin, vergeht kein Jahr, in dem ich nicht
mindestens einmal in Baiersbronn beim Schwimmbad oder am Sankenbach übernachte.
- Untergrombach und Bretten -
Meinem Versetzungswunsch wurde stattgegeben,
mein Ortswunsch aber verworfen.
So fuhr ich Ende April 1964 mit dem neu
erworbenen Opel Rekord zu meinem ersten Unterrichtstag nach Untergrombach und
übernahm dort eine vierte Klasse.
Im Vergleich zu dem konservativen und etwas
prüden Baiersbronn waren die Untergrombacher ganz anders – Kinder und
Erwachsene: fröhlicher, offener, direkter, sie nahmen alles etwas leichter.
Es gefiel mir dort, und ich hatte mit den
36 Buben und Mädchen ein angenehmes Jahr.
Das Lästigste waren die Fahrten, ob mit
Auto oder auf der Schiene.
Ich vermute, dass dieser Faktor auch die
eigentliche Ursache für meinen erneuten Veränderungswunsch war, sodass ich ab
April 1965 an der Schillerschule in Bretten eine 5.Klasse übernahm; es waren
alles Mädchen.
Es zeigte sich bald, dass wir ausgezeichnet
harmonierten, und so verbrachten wir eineinhalb tolle Jahre miteinander.
Der Höhepunkt war mein Geburtstag im
September, als sie es schafften, den mürrischen und grantigen Hausmeister
Kleiber irgendwie zu bewegen, dass er sie vor Unterrichtsbeginn in das Gebäude
ließ.
Als ich das Zimmer betrat, standen sie alle
auf und sangen ein Lied, und erst etwas später merkte ich, dass mein Tisch mit
Blumen überhäuft war; auch auf jeder Bank stand ein kleiner Blumenstrauß.
Warum nur eineinhalb Jahre?
Einige Länder in der BRD hatten 1964
beschlossen, den Schuljahreswechsel auf den Herbst zu verlegen, wozu natürlich
zwei Kurzschuljahre notwendig wurden.
Trotz großer Proteste in ganz Deutschland
wurde diese Maßnahme durchgesetzt, sodass für die Kinder ihre 7.Klasse am
30.November 1966 zu Ende war, und sie vom 1.Dezember 1966 bis zum 31.Juli 1967
die 8.Klasse absolvierten.
Für diese Zeit von Dezember 1966 bis Juli
1967 waren weitere einschneidende Maßnahmen notwendig geworden: in einem
autoritären Verwaltungsakt, dessen Sinn bzw. Unsinn uns niemand erklären konnte
oder wollte, wurden einige Mädchen aus der Klasse genommen und die freien
Plätze nahmen Buben ein.
Da die Schulraumnot immer prekärer wurde,
wies man uns einen notdürftig ausgestatteten Saal im Obergeschoss der alten
Turnhalle neben dem Melanchthongymnasium zu. Ohne Handschuhe, Mäntel und Decken
hätten wir den Winter kaum überstanden.
Ich hatte die nun gemischte Klasse im
Dezember 1966 übernommen und unterrichtete sie bis zum Ende des 8.Schuljahres (Juli
1967).
Nach einem etwas holprigen Beginn bahnte
sich aber zu Beginn des Jahres 1967 eine fruchtbare und angenehme
Zusammenarbeit an, die durch nichts Negatives beeinträchtigt wurde.
Ich freute mich auf jeden Schultag in
Bretten.
Durch die zur Jahreswende 1964-65
beschlossene Bildungsreform in Baden-Württemberg wurde aus der Volksschule eine
Hauptschule; die signifikanteste Änderung bestand darin, dass die gesamte
Schulzeit jetzt neun Schuljahre umfasste.
Ich ging noch im Juli 1967 fest davon aus,
dass ich meine Klasse auch im 9.Schuljahr unterrichten würde; es gab keinen
Grund für einen Wechsel.
Als aber Rektor Dörr in der
Abschlusskonferenz die geplante Klassenverteilung für das Schuljahr 1967-68
bekannt gab, glaubte ich zunächst, meinen Ohren nicht zu trauen, denn seinen
Ausführungen nach sollte Kollege Rogausch meine Klasse übernehmen.
Sofort nach Konferenzende suchte ich das
Gespräch mit ihm, und er begründete seine Maßnahme mit Argumenten, deren
Glaubwürdigkeit sich mir völlig verschloss.
Ich vermute heute, dass es seinerseits ein
humanitärer Akt gegenüber dem etwas gesundheitlich angeschlagenen Kollegen war;
die Klasse galt in jeder Hinsicht als vorbildlich, so dass Dörr Probleme,
sprich: Vertretungen, durch seinen Akt mit einiger Sicherheit ausschließen
konnte.
Was tat ich?
Möglicherweise das Falsche, denn die zwei
Jahre in Bretten waren äußerst angenehm gewesen, Umfeld, Schüler und Kollegium
betreffend.
Ich fühlte mich wohl dort, empfand aber die
Zurücksetzung als Affront, der meine persönliche Integrität verletzte, so dass
ich zum Schulamt nach Karlsruhe fuhr und um meine Versetzung nach Mühlbach bat;
ich hatte erfahren, dass dort ein Kollege die Schule verlassen hatte.
Der Schulrat machte mir wenig Hoffnung, vor
allem auch deshalb nicht, weil mit der Versetzung nicht nur ein Ortswechsel,
sondern auch ein Wechsel des Regierungsbezirks verbunden wäre.
- Mühlbach -
Umso überraschter war ich, als Anfang
September 1967 meine Versetzung in unseren Nachbarort Mühlbach eintraf, so dass
ich mich zu Beginn des neuen Schuljahres in dem Steinhauerdorf vor 42
Fünftklässlern wiederfand.
Zu diesem Zeitpunkt hätten wir nicht
geahnt, dass wir fünf Jahre miteinander auskommen mussten, aber dem war so,
denn im Zuge der Schulreform wurde die Oberstufe der Volksschule Mühlbach im
Herbst 1968 nach Eppingen abgeordnet, und man wollte den Kindern zu all dem
Neuen, das dieser Umzug mit sich brachte, nicht noch durch den eigentlich
notwendigen Lehrer- wechsel ein fremdes
und unbekanntes Gesicht zumuten.
Es wurden ereignisreiche fünf Jahre.
Da für mich auch alles zum ersten Mal war,
alles neu war, packte ich die Projekte und Vorhaben mit großem Engagement und
einer gespannten Neugierde an.
Es würde einen zu großen Raum beanspruchen,
alle Aktivitäten hier aufzuführen, deshalb in Umrissen nur kurz die
Markantesten:
Unser erster Ausflug führte uns mit dem Bus
über Pforzheim, Besenfeld und Baiersbronn hinauf zum Ruhestein.
Nach einer Vesperpause erklommen wir diesen
Berg und wanderten am Wildsee vorbei – einige ließen es sich nicht nehmen und
kletterten zu ihm hinunter – zur Darmstädter Hütte.
Weiter ging es dann hinunter zum
Seibelseckle und wieder hinauf zum Mummelsee und mit dem Bus über Karlsruhe
zurück.
Da bis 1969 noch niemand unserer Schule im
Schullandheim gewesen war, wollten wir die Ersten sein, die ein solches
Unternehmen in Angriff nahmen.
Ab Anfang des Jahres 1970 konnte jedes Kind
samstags in der letzten Stunde einen selbst bestimmten Geldbetrag bei mir
einbezahlen; der Einzahler bestätigte den Betrag durch seine Unterschrift.
Im März desselben Jahres lieh ich mir einen
Traktor, und wir sammelten in Eppingen an zwei Regensamstagen von morgens bis
abends Altpapier, das wir in einen Container der Firma Stuhlmüller aus Richen
verfrachteten; er stand auf dem Reitplatz.
Dasselbe wiederholte sich einige Wochen
später in Mühlbach und Adelshofen (aus diesen Teilgemeinden kamen die Kinder).
Etwa 400 Mark kamen dabei zusammen.
Weitere 300 Mark kamen durch Einsammeln von
Alteisen in die Kasse, wiederum mit einem geliehenen Traktorengespann, und
ergänzt wurde unser doch schon angeschwollenes Sparschwein durch Spenden der
größeren Firmen und Banken in Eppingen, die ich angeschrieben hatte.
Da damals noch jedes Kind vom Landkreis
Heilbronn, von der Zentralgemeinde und seiner Heimatgemeinde mit je einer Mark
pro Tag unterstützt wurde, hatten sich Ende Juli 1970 über 12000 DM auf unserem
Sparbuch angesammelt.
Blieb nur noch die Frage:
Wo geben wir dieses Geld denn aus?
Außer einem Jugendherbergsverzeichnis von
Deutschland hatte ich nichts auftreiben können; daneben gab es neben ein paar
Naturfreundehäusern eben nichts.
Die potentiellen Zielorte bewegten sich von
der Nordsee über den Bayrischen Wald und dem bayrischen Alpenraum bis zum
Bodensee und dem Schwarzwald.
Mit meinem Campingbus war ich in den
Pfingstferien 1970 zusammen mit vier Kindern auf Besichtigungstour durch den
Schwarzwald und am Rhein entlang wieder zurück.
Das Rennen machte schließlich die
Jugendherberge in der Bruderhalde am Titisee.
In ihr wollten wir zwei Wochen verbringen.
Am 12.September, einem sonnigen Samstag,
trafen sich also 39 Kinder und ihr Lehrer am Bahnhof in Eppingen und fuhren mit
dem Zug nach Karlsruhe, von wo es dann mit der „Schwarzwaldbahn“ über
Offenburg, Wolfach, Hornberg, Triberg und St.Georgen nach Donaueschingen ging.
Den kurzen Aufenthalt nutzten wir für den
Besuch der Donauquelle.
Gegen 15 Uhr kamen wir am Bahnhof in
Titisee an, und nachdem alle Koffer und Taschen auf einem Bauernwagen verstaut
waren, machten wir uns zu Fuß über den Waldweg auf den Weg zur Jugendherberge.
Ich kann mich noch erinnern, dass die
Kinder so aufgeregt und gespannt waren auf das, was sie in Kürze erwartete,
dass sie den tiefblauen See und die schöne Landschaft überhaupt nicht
wahrnahmen, obwohl ich sie immer wieder darauf hinwies.
Ich hatte selbst ein mulmiges Gefühl, denn
es war meine erste Fahrt in ein Schullandheim, aber es verlief alles
glatt, und nach einer Stunde waren alle
untergebracht.
Der Leiter der JH, Herr Herr - so hieß er
wirklich - unterrichtete mich über alles
Wissenswerte und unternahm mit mir dann einen kleinen Rundgang durch das alte
Gebäude.
Da wir die nächsten zwei Wochen seine
einzigen Gäste waren, konnten wir alle Räumlichkeiten für unsere Zwecke nutzen.
Vor dem Abendessen versammelte ich die Kinder
im Aufenthaltsraum, informierte sie über alles, was sie wissen mussten und
verteilte die Aufgaben für die nächsten drei Tage (Tisch decken, Essen auf- und
abtragen, abspülen, ausfegen, etc.).
Nach dem Essen machten wir noch eine kleine
Wanderung runter zum See.
Am nächsten Tag - einem Sonntag - wurden in
der kleinen Kirche in Titisee die Stühle knapp.
Inzwischen war auch meine Frau mit unserem
Auto eingetroffen; trotz ihrer Schwangerschaft hatte sie es nicht nehmen
lassen, als Begleitperson an dem Aufenthalt teilzunehmen.
Was ist noch präsent von diesen 14 Tagen im
Schwarzwald?
Über die gesamte Zeit schien die Sonne,
sodass wir immer wieder zum Schwimmen an den See gingen.
Die meisten Tage unserer Tage waren von
ausgedehnten Wanderungen ausgefüllt.
So marschierten wir von der JH hinauf zum
Gipfel des Feldberges, dann steil hinunter zum Feldsee und über den Raimartihof
den weiten Weg zurück zur JH, insgesamt weit über 20 km.
An einem weiteren Tag liefen wir nach
Bärental, nahmen dann den Zug bis Aha am Schluchsee und wanderten anschließend
um den gesamten See herum wieder zurück nach Aha, nur unterbrochen von einer
einstündigen Rast am Unterkrummenhof.
Mit dem Zug ging es dann wieder nach
Bärental und zu Fuß über Erlenbruck zurück zur JH.
Als anstrengend und recht schwierig erwies
sich unsere Wanderung zum Hochfirst mit seinen knapp 1200 m.
An zwei Vormittagen blieben wir in der JH
und beschäftigten uns mit der Geschichte und der Geografie des Schwarzwaldes.
Zwei Tage vor Ende unseres unvergesslichen
Aufenthalts am Titisee fuhren wir mit einem Bus über Bonndorf zum Rheinfall von
Schaffhausen in die Schweiz; für viele war dies einer der schönsten Tage.
Nicht nur empfanden sie die stürzenden
Wassermassen des Rheins als sehr beeindruckend, vor allem genossen sie es, dass
sie sich an diesem Tag nicht viele Kilometer durch den Schwarzwald mühen
mussten und endlich einmal einen ruhigen Tag genießen konnten.
Einmal geht auch die schönste Zeit vorbei,
und so holte uns der Bauer-Bus am 26.9.1970 wieder ab; um die Mittagszeit waren
wir alle wieder unversehrt und voll mit vielen unvergesslichen Eindrücken im
Kraichgau angekommen.
(Dieser Schullandheimaufenthalt war mein
erster mit einer Klasse und der Startschuss zu 20 weiteren).
Die Basis zum nächsten war durch unseren
großen finanziellen Überschuss bereits wieder gelegt:
Wir waren mit über 12000 DM zum Titisee
gefahren, hatten aber nur insgesamt 5300 DM verbraucht (Vollpension in der JH:
5,30 DM/Tag/Kind).
So machten wir bald Pläne, welche neuen
Ziele wir ansteuern sollten., hatten aber zunächst noch einige andere
Exkursionen vor uns.
Zwei Tage vor den Weihnachtsferien
besuchten wir eine Sitzung des Landtags in Stuttgart und nutzten den
anschließenden Stadtbummel, um noch notwendige Utensilien für unseren
Schullandheimaufenthalt in Südtirol einzukaufen.
Richtig verstanden.
Unsere prall gefüllte Klassenkasse erzwang
geradezu neue „Abenteuer“, und ich hatte wochenlange Vorbereitungen für einen
Skiaufenthalt in Südtirol hinter mir.
Nur zwei der Kinder besaßen eigene Skier,
und es schien zunächst ein aussichtsloses Unterfangen zu sein, dass 39
„Landratten“ in die Berge zum Skilaufen fahren würden, aber mein anfangs mit
großer Skepsis aufgenommener Plan setzte sich allmählich umso mehr durch, desto
detaillierter die Informationen waren, die ich den Eltern vorlegen konnte.
Ende November 1971 waren alle Kinder mit
mehr oder minder tauglichen Skiern versorgt; wir hatten dazu die
verschiedensten „Quellen“ angezapft.
Und dann war es tatsächlich so weit:
Am 25.Januar 1972 (einem sonnigen Samstag)
startete wiederum „Charly“ mit einem bis an seine Grenzen beladenen Bauer-Bus
und brachte seine – mit der Dauer der Fahrt immer ungeduldiger werdende Fracht
– über Stuttgart, Ulm, Augsburg, München (Besuch des Olympiageländes mit Auffahrt
zum Olympiaturm), Garmisch-Partenkirchen (Besuch der Olympiaschanze) –
Mittenwald – Innsbruck – Brennerpass – Sterzing – Franzensfeste – Einfahrt ins
Pustertal – St.Lorenzen und dann endlich hinauf nach St.Stefansdorf; dort
quartierten wir uns im „Mair-Hof“ ein.
Um noch einen Teil des üppig vorhandenen
Adrenalins abzubauen, unternahmen wir nach dem Abendessen eine ausgedehnte
Wanderung durch das tief verschneite, kleine und wie ausgestorben wirkende
Dorf.
Da meine eigenen Kenntnisse und Fähigkeiten
in der Fortbewegung auf zwei Brettern äußerst bescheiden waren – nach dem Krieg
sind wir auf „Fassdauben“ durch die Hügel Sulzfelds gestapft, in Baiersbronn
hatte ich mir Morlock-Skier gekauft und war mit ihnen in Mitteltal einige Male
herumgekurvt - hatte ich mir Literatur besorgt, um meine Unterweisungen etwas
untermauern zu können.
So versuchte ich die nächsten vier Tage,
den Kindern auf den Hügeln rund um den „Mair-Hof“ in groben Zügen die
Grundkenntnisse und einfachen Fähigkeiten dieser Sportart beizubringen.
Als dann alle einigermaßen „Stemmbogen“ und
„Schneepflug“ beherrschten, hielt ich die Zeit für gekommen, das Gelernte am
nahen „Kronplatz“ zu testen und evtl. Neues auszuprobieren.
Es war sehr kalt, als wir am Donnerstag in
der ersten Woche nach dem Frühstück die 1200 m hinüber zur Talstation der
Kronplatz-Kabinenbahn auf den Skiern zurücklegten; Schnee gab es massenhaft.
Ich kaufte Karten für den etwa 300 m langen
Korer-Schlepplift neben der Seilbahn, und es dauerte kein 10 Minuten, bis die
ersten Wagemutigen mit hohem Tempo und großem Geschrei den Abhang
heruntersausten.
Gegen 13 Uhr machte sich meine Kollegin,
Frau Burkert, mit einem kleineren Teil der Klasse auf den Rückweg, während die
anderen auch um 17 Uhr schwer zu bewegen waren, das Gelände zu verlassen.
Meinen Plan, am nächsten Tag zum Kronplatz
hochzufahren, musste ich aufgeben, denn beim Frühstück wurde mir klar, dass die
ganze Bande völlig erschöpft war.
Sie trieben sich dann am nächsten Tag mit
ihren Skiern in der Umgebung herum oder hielten sich im Haus auf.
Am Samstag wanderten wir im Tiefschnee die
4 km nach Bruneck hinunter und schauten uns den Film „Doktor Schiwago“ an; der
Verbrauch an Taschentüchern war enorm.
Am Montagmorgen konnte dann das Abenteuer
„Kronplatz“ beginnen.
Schon während der Auffahrt mit der Seilbahn
zum Kronplatz hinauf kamen die meisten aus dem Staunen nicht heraus, war es
doch das erste Mal, dass sie so etwas erlebten.
Dieses Staunen setzte sich auf dem
Gipfelplateau fort, denn der an diesem herrlichen Sonnentag gebotene Rundblick
über die glitzernde Bergwelt war einfach überwältigend.
Wir fuhren zusammen etappenweise den nicht
allzu steilen Südabhang des Kronplatzes hinunter und beobachteten dann noch
zusammen einige Zeit das Verhalten an einem Schlepplift. Als der Letzte dann am
Bügel hing, fuhr auch ich hinterher.
Diese Prozedur wiederholten wir nochmals,
dann gab ich ihnen zwei Stunden Zeit, die sie an diesem Südhang verbringen
konnten/mussten; er war übersichtlich, und ich hatte sie im Auge.
Manche hatten bald genug vom Skifahren und
legten sich oben in die Sonne.
Gegen 16 Uhr fuhren wir wieder mit der
Seilbahn hinunter, da mir der Nordhang für eine Talfahrt etwas zu riskant
erschien, und viele der Kinder konditionell nicht mehr in bester Verfassung
waren.
Die vier Tage bis zur Heimfahrt verbrachten
wir bei herrlichem Wetter und bestem Schnee auf dem Kronplatz, die Talfahrt
über den Nordhang schafften bereits am Dienstag die meisten, und sie war dann
stets der Höhepunkt des Tages.
Manchmal blieb mir beinahe das Herz stehen
beim Anblick der „Verrücktesten“, und ich war immer heilfroh, wenn ich sie alle
gesund wieder zum „Mair-Hof“ gebracht hatte.
Nach der letzten Abfahrt am Freitag setzte
heftiges Schneetreiben ein, und der gegen 18 Uhr eintreffende „Charly“ war
nicht sicher, ob es mit der morgigen Heimfahrt klappen würde.
Bis nach Mitternacht wurde Abschied
gefeiert, und am nächsten Morgen machte sich eine müde Gruppe und ein etwas
angeschlagener Fahrer auf den langen Heimweg.
Erst am späten Abend kamen wir wieder müde,
aber gesund im Kraichgau an; niemand war krank geworden oder hatte sich
verletzt, alle brachten nur schöne Erinnerungen an schöne Tage mit nach Hause.
Im Februar begannen dann die Vorarbeiten
für die im Zuge der Schulreform erstmalig abzulegende „Hauptschulabschlussprüfung“.
Da auch Fertigkeiten in einem musischen
Bereich gefordert wurden, besorgte ich für Dreiviertel der Klasse Blockflöten
und unterwies sie zunächst im Notenlesen, bis wir dann die ersten einfachen
Liedchen einüben konnten.
Es müssen etwa zehn Kinder gewesen sein –
darunter mehrere Jungen – die in Musik die Prüfung absolvierten; niemand fiel
durch.
Neben den geschilderten Unternehmungen
haben wir in den fünf Jahren noch viele Wanderungen, Radtouren,
Schlittenfahrten, Schwimmbad-und Museumsbesuche und andere Projekte
durchgeführt.
Ein sehr schöner Ausflug war die Fahrt mit
dem Zug nach Neckargemünd, die Wanderung hinüber nach Neckarsteinach und dann
die Schifffahrt nach Heidelberg.
Nach der Stadtbesichtigung ging es mit der
Bergbahn zunächst zum Schloss und dann hinauf zum Königstuhl.
Von dort war es dann ein langer Marsch
hinunter nach Bammental, wo uns der Bauer-Bus abholte.
Mit die härteste Tour war die Wanderung
über Sternenfels zum Kloster nach Maulbronn und wieder zurück (knapp 30 km).
Als ein paar Jahre später ein Junge bei
derselben Wanderung gesundheitliche Probleme bekam, verzichtete ich auf diese
Gewaltmärsche und modifizierte den Besuch des Klosters dahingehend, dass wir
mit dem Zug nach Gölshausen fuhren, durch den Wald nach Maulbronn marschierten
und uns dann von einem Bus am Tiefen See abholen ließen.
- Eppingen -
Wenn ich auf die 31 Jahre in Eppingen
zurückschaue, sehe ich zwei völlig konträre Seiten einer Medaille: einerseits
tauchen da schöne Bilder mit unvergesslichen Unternehmungen und Erlebnissen mit
Kindern und einem tollen Kollegium auf, andererseits verdunkelt der Schatten
eines überforderten und autoritären Schulleiters 11 Jahre meines Lebens an
dieser Schule.
Zum Glück konnten seine Nachfolger vieles
kompensieren und ermöglichten so ein wesentlich stressfreieres Arbeiten und
Unterrichten.
Mit einer Ausnahme war ich immer
Klassenlehrer in den oberen Klassen, in der Regel sieben bis neun. Ich
unterrichtete immer die Kinder aus der Zentralstadt; die Schüler aus den
Nachbardörfern galten als „pflegeleichter“.
Meine außerschulischen Unternehmungen mit
den Kindern nahmen im Laufe der Zeit noch zu.
Wenn in den Klassen 7 und 8 nähere Ziele im
Vordergrund standen - Kloster Maulbronn, Heidelberg und sein Schloss, der nördliche
Schwarzwald, Karlsruhe, Schleuse in Heilbronn, Tripsdrill, viele Ausflüge und
Wanderungen in der Peripherie Eppingens, Betriebsbesichtigungen und vieles
andere - waren in den Abschlussklassen anspruchsvollere Exkursionen
obligatorisch.
Im Laufe des Schuljahres 1971-72 hatte ich
von irgendwo her die Information erhalten, dass die Kosten für einen Besuch des
Landtages in Stuttgart und des Bundestages in Bonn - später in Berlin - zum
größten Teil vom Land bzw. Bund übernommen werden.
Nachdem sich diese Information bewahrheitet hatte, machte ich
mich sofort an die Planungen, und bereits Anfang Januar 1972 saßen etwa 40
Kinder der 9c auf den Zuschauerbänken des Landtages in Stuttgart; nach einer
Diskussion mit Minister Leibfried mit einem Imbiss und einem Besuch des
Fernsehturms, nutzten viele Kinder - und der Lehrer - den Gang durch
Stuttgarter Innenstadt, um noch einige Utensilien für den acht Tage später
anberaumten Schullandheim in Südtirol zu besorgen.
Im Juli 1972 besuchten wir eine Sitzung des
Bundestages in Bonn (übernachtet hatten wir in der Jugendherberge in
Köln-Godesberg).
Für die Rückfahrt hatte ich die Route auf
Grund des herrlichen Wetters spontan etwas verändert, sodass wir in Koblenz ein
Rheinschiff bestiegen und durch den möglicherweise schönsten Teil des Rheins
bis nach Rüdesheim hinunterfuhren.
Dort erwartete uns bereits „Charly“ mit
seinem Bus, und wir fuhren über Worms, Mannheim und Speyer wieder zurück in den
Kraichgau.
Es waren drei schöne und erlebnisreiche
Tage gewesen.
(Bei späteren Fahrten zum Bundestag nach
Bonn – die für uns ebenso wie die Besuche des Landtags in Stuttgart und später
des Bundestags in Berlin alle kostenlos waren – fuhr ich bei der Rückfahrt über
die Eifel und den Nürburgring).
Ein Erlebnis der besonderen Art war die
Fahrt durch die DDR und der Besuch einer Bundestagssitzung in Berlin, sowie der
am nächsten Tag erfolgende Grenzübertritt nach Ostberlin.
Auch 40 Jahre später löst die Erinnerung
daran noch die zwiespältigsten Gefühle aus; ich denke, das Positive überwog,
aber es waren jeweils vier Tage, geprägt von einem Gefühl der Unsicherheit und
einer gespannten Erwartung. Man wusste einfach nicht, ob doch noch etwas
passieren würde.
Eine Episode möchte ich noch gerne
anführen:
Nach der Einfahrt in die DDR bei Plauen
durfte man die Transitautobahn bis Berlin nirgends verlassen; nur an einigen
speziellen Autobahnraststätten konnte man eine Pause einlegen.
Nachdem wir nach einer kurzen Pause die
Raststätte Willsdruff bei Dresden wieder verlassen hatten, bemerkte ich kurz
vor Berlin, dass meine braune Umhängetasche fehlte; ich musste sie in der
Raststätte vergessen haben, mit allen Unterlagen und etwa 8000 Mark darin.
Zum Glück hatte ich vor dem Grenzübertritt
alle Pässe und Personalausweise ausgeteilt, sodass wir ohne Probleme nach
West-Berlin einreisen konnten; den abgelaufenen Pass meiner Frau hatte der
Beamte übersehen.
Die telefonische Nachfrage in Willsdruff
erwies sich als äußerst kompliziert, denn erst über das westdeutsche Auswärtige
Amt musste in Ost-Berlin um die Erlaubnis für einen dortigen Anruf nachgefragt
werden.
Als mir dieser Rückruf gegen Mitternacht
gestattet wurde, war ich über die erhaltene Nachricht mehr als erleichtert: Die
Tasche hatte man gefunden und wollte sie bis zu unserer Rückfahrt aufbewahren.
Mit Hilfe der Scheckkarte meiner Frau
besorgten wir uns das notwendige Bargeld, sodass wir alle geplanten
Unternehmungen durchführen konnten, darunter auch einen ganztägigen Besuch
Ost-Berlins.
Auf der Rückfahrt gab es natürlich nur ein
Thema: bekomme ich die Tasche wieder?
In der Raststätte bat man mich in das in
einem Seitentrakt befindliche Büro der VOPO, und schon beim Eintritt sah ich
sie auf dem Tisch liegen; eine kurze
Überprüfung ergab eine völlige Unversehrtheit der Tasche mitsamt ihres Inhalts.
Ich entnahm ihr zwei Einhundertmarkscheine
und wollte sie den Beamten mit den entsprechenden Dankesworten überreichen, was
sie aber entrüstet ablehnten.
Als ich in den Bus einsteigen wollte, stand
wie zufällig einer der Beamten neben dem Aufgang, und ohne Zögern nahm er das
Geld entgegen; ich vermute, dass der offizielle Übergabeakt im Büro - in der
Anwesenheit weiterer Beamter - gegen einschlägige Gesetze verstoßen hätte. Ob
der Beamte das Geld für sich behielt oder nachher unter die anderen Beamten aufteilte,
ist irrelevant; ihr Verhalten in Bezug auf die gesamte Angelegenheit der Sache
mit der vergessenen Tasche hat mich äußerst positiv überrascht.
Ich möchte zum Schluss noch kurz zwei
Unternehmungen anführen, die in der Art ihrer Durchführung doch etwas aus dem
Rahmen fielen.
Zum ersten war es eine Fahrt mit der 9c von
Herrn Fischer nach Saalbach-Hinterglemm in den Osterferien 1974.
Ob der Schulleiter ihm die Fahrt verwehrte,
oder ob der kurz vor der Pension stehende Kollege Fischer dem Wunsch der Klasse nicht entsprach, weiß
ich heute nicht mehr.
Als mich einige Tage später die
Klassensprecher während einer Hofaufsicht fragten, ob ich nicht Lust hätte, mit
ihnen ins Schullandheim zu fahren, sagte ich spontan zu; ich kannte die Klasse,
alle Kinder waren aus Mühlbach und Adelshofen; potentielle Probleme tendierten
somit gegen Null.
Als ich nach Schulschluss im Rektorat mein
Anliegen vortrug, erfuhr ich eine rüde Abfuhr, was mich wenig überraschte;
Argumente wurden nicht für nötig gehalten.
Ich machte der Klasse dann den Vorschlag,
den Aufenthalt in den kommenden Osterferien durchzuführen.
Zwei Tage später erklärten sie mir, dass
bis auf zwei Mädchen alle einverstanden seien.
In einer kurzfristig anberaumten
Versammlung informierte ich die Kinder und ihre Eltern in der „Talschenke“ über
die Details des geplanten Vorhabens und vor allem darüber, dass es sich um
keine schulische Veranstaltung handelte und damit jeglicher Versicherungsschutz
wegfiele; auch meine Funktion als Lehrer und somit der gesetzlichen Aufsichtspflicht
Verpflichtender sei nicht gegeben, sie hätten demgemäß meinen Anordnungen nicht
folgen müssen.
Ich hatte ein entsprechendes Schreiben
vorbereitet und gab es ihnen mit nach Hause. Um eine notwendige
Haftpflichtversicherung hatte ich mich bereits im Vorfeld gekümmert; die Kosten
in Höhe von 147 DM würden wir uns teilen.
Etwa drei Wochen vor den Osterferien hatte
ich alle beglaubigten Schriftstücke in meinem Ordner und konnte mich daran
machen, nach einem geeigneten Ziel zu suchen, was nicht ganz einfach war; mit
den heutigen „Hilfsmitten“ - sprich Medien/Internet - ein Klacks.
Nachdem ich ein Heim in
Saalbach-Hinterglemm gefunden hatte, nach drei informellen Zusammenkünften und
nachdem der „Bauer-Bus“ organisiert war, starteten früh am 15.April 1974 - es war Ostermontag -
32 Kinder und meine Familie (unsere dreijährige Tochter war auch dabei) gen
Süden und erreichten - nach einem Besuch des Olympiastadions in München - am
späten Nachmittag unser Ziel, wo wir zwei abwechslungsreiche und unterhaltsame
Wochen miteinander verbrachten; meine positive Einschätzung der Kinder war voll
eingetroffen.
Weitere etwas ungewöhnliche Aktionen waren
die drei Besuche der britischen Hauptstadt, die wir teils mit dem Zug, ein
andermal mit dem Flugzeug erreichten.
Das erste Projekt wurde von einem Reisebüro
organisiert (Flug, drei Übernachtungen für 199 DM).
Dementsprechend billig war auch alles: im
Flug saßen wir in einer dröhnenden BAC-111 - manche von Angesicht zu Angesicht
- und untergebracht waren wir in einem nicht heizbaren, ehemaligen königlichen
Pferdestall; aber diese Umstände spielten für die 69 Kinder und Jugendliche,
von denen viele ihre Freunde aus anderen Schulen mitgebracht hatten, damals
keine Rolle.
Es wurden vier unterhaltsame,
erkenntnisreiche und spannende Tage, aber ich war trotzdem mehr als froh, als
wir wieder alle gesund im Kraichgau gelandet waren, und ich nahm mir vor, beim
nächsten Mal nicht ohne eine weitere Begleitperson nach London zu reisen.
Für den zweiten Besuch in London hatte ich irgendwie
herausgefunden, dass freitags ein Jumbo Jet der „Singapore Airlines“ auf seinem
Weg von Singapur nach London in Frankfurt zwischenlandete, und nachdem ich in
einem Brief an das Frankfurter Büro der Airline mein Anliegen vorgetragen
hatte, waren wir
Auf dem
Flughafen Frankfurt einige Zeit später im Besitz der
äußerst günstigen Flugtickets; wie spekuliert, waren die Sitzplätze der
riesigen 747 nur zu einem Bruchteil besetzt.
Bei der Rückfahrt fuhren wir zunächst mit
dem Zug nach Dover, überquerten mit dem Schiff den Kanal und bestiegen dann in
Ostende den Schnellzug nach Heidelberg; über Sinsheim erreichten wir am späten
Nachmittag unseren Heimatort Eppingen.
Für den zweiten und dritten Besuch Londons
reisten noch drei Kollegen und eine Kollegin mit; da diese Exkursionen wiederum
in den Faschingsferien stattfanden, mussten wir natürlich erneut alle privat
versichert werden.
Eine kurze Anmerkung:
Wenn
man sich während eines Schullandheimaufenthalts, bei einem Ausflug oder anderen
Unternehmungen „legal“ verhalten würde, sollte man lieber zuhause bleiben, denn
alles, was den Reiz solcher Unternehmungen ausmacht, ist verboten: Schwimmen,
einen Sessellift oder eine Bergbahn zu besteigen, Bootfahren oder Bergsteigen.
Ich
habe immer wieder gegen diese Vorschriften verstoßen, weil ich bereits bei meinen ersten Projekten in
Baiersbronn, Untergrombach und Bretten die Erfahrung gemacht hatte, dass sich
Vertrauen in Kinder auszahlt, allerdings unter einer Bedingung: man muss sie informieren
und aufklären, ihnen deutlich machen, was die Folgen ihres eventuellen
Fehlverhaltens für sich selber, aber auch für mich als Verantwortlicher, sein
könnten; sie müssen in nicht vorhersehbaren Situationen genau wissen, wie sie
sich zu verhalten haben. Z.B. haben wir vor unseren Bergunternehmen in Südtirol
(Drei Zinnen, Dürrenstein, Sarlkofl, Plätzwiese, Monte Piano, etc.) Themen wie
„Gefahren der Berge“, „Wetter in den Bergen“ und „Notsignale in den Bergen“ im
Unterricht intensiv behandelt.
Ich
bin in den 37 Jahren nur einmal von einem unberechenbaren Einzelgänger
enttäuscht worden, ansonsten war es meistens so, dass sich die Kinder nach
ihrer „Freizeit“ bereits weit vor dem vereinbarten Zeitpunkt wieder am
festgelegten Treffunkt einfanden.
Ich
denke, eine präzise Vorbereitung und Information haben - wie möglicherweise
auch manchmal eine gewisse Portion Glück - dazu beigetragen, dass von den etwa
1800 Kindern, mit denen ich unterwegs war, niemand zu Schaden gekommen ist.
Da es mich im Zusammenhang mit diesem
„Rückblick“ einfach interessiert hat, was da in knapp 40 Jahren alles zusammen
gekommen ist, habe ich in den vorhandenen Alben, Berichten und sonstigen
Unterlagen mal nachgeschaut und etwas bilanziert:
2-wöchige Aufenthalte: 12
1-wöchige Aufenthalte: 9
London-Fahrten (4 Tage): 3
Bonn (3 Tage): 5
Stuttgart (1 Tag): 5
Berlin (4 Tage): 3
Zelten (Bodensee-5 Tage): 5
Dazu kommen noch über 100 Wanderungen und
12 Betriebsbesichtigungen.
12 Jahre habe ich die Fußball-AG an unserer
Schule geleitet und bin mit den Buben in meinem Bus zu vielen Turnieren und
„Olympia“-Spielen gefahren, ohne irgendwelche Kostenerstattung und
Versicherung; man tat es einfach, ohne groß darüber nachzudenken.
Als dann aber ein Kollege, den ich gebeten
hatte, vier Spieler in seinem BMW mitzunehmen, denselben zu Schrott gefahren
hatte und von keiner Seite irgendwelche Unterstützung und Hilfe bekam, stoppte
ich unverzüglich diese Fahrten und gab die Fußball-AG auf.
An ihre Stelle rückte dafür eine Tennis-AG,
die ich einige Jahre leitete.
1984 trat ein Medium in mein Blickfeld, das
mich bis heute beschäftigt: die „Computerei“.
Gegen meinen Rat wurde von der Schulleitung
ein Klassenzimmer mit Amstrad-Schneidercomputern ausgestattet; sie waren etwas
billiger als die von mir gewünschten Atari, mussten aber schon kurze Zeit
danach durch PC mit Intel -Prozessoren ersetzt werden.
Ich kannte mich mit meinem Amiga 2000 aus,
hatte aber von der Installation eines Netzwerkes, das 15 Einzelplätze und einen
Zentralserver umfassen sollte, keine Ahnung.
Ich besorgte mir eine Menge Literatur,
entnahm ihr auch einiges, konnte dann aber den Server mit seinen 15 Computern
nicht in Gang bringen.
Erst als ich die Anschaffung eines
IBM-Programms durchsetzen konnte, wurde es besser, und an den einzelnen
Computern konnten die Kinder dann arbeiten.
Den eigentlichen Sinn und Zweck eines
Netzwerkes - ein Zentralrechner bedient die angeschlossenen Einzelgeräte -
konnte ich nicht realisieren; hauptsächlich verhinderten Hardwareprobleme ein
optimales Arbeiten.
So musste ich alle Programminstallationen,
Updates und Korrekturen an jedem der 15 PCs separat durchführen; ein Zeit und
Energie verschlingender Aufwand (als ich 1998 aus dem Schuldienst ausschied,
hatten sich 1400 Unterrichtsstunden angesammelt, die ich im Computerraum in
meiner Freizeit verbracht hatte).
Im Herbst 1998 nahm mein „Lehrerleben“ ein
abruptes Ende, ein Ende, das ich mir anders vorgestellt und gewünscht hätte.
Die enttäuschenden, verständnislosen und
oft verletzenden Reaktionen großer Teile des Kollegiums haben mich viele Jahre
belastet und deprimiert; ich bedauere nur, dass ich ihre Belanglosigkeit nicht
früher verstanden habe. Möglicherweise hatte ich sie auch nicht entsprechend
informiert, und Nichtwissen ist immer die Basis für Spekulationen.
Wie vergingen die letzten zwanzig Jahren?
Mit drei Worten: eindeutig zu schnell.
Wie reagierte ich nach meinem Arbeitsende?
Ich brach alles hinter mir ab.
Ich trat aus sämtlichen Vereinen aus,
spielte kein Tennis mehr und verließ 10 Jahre lang kaum das Haus; auch die
Schule habe ich nie wieder betreten, obwohl ich mich unzählige Male - meistens
abends - auf dem Gelände herumtrieb.
Depressionen und Probleme mit meiner Pumpe
blockierten nahezu alle Aktivitäten.
Als 2008 zwei weitere Stents implantiert
waren, und ich mir 2010 mein erstes E-Bike (ein Flyer) gekauft hatte, änderte
sich meine Situation zum Besseren.
Die letzten acht Jahre unternahmen wir auch
wieder einige Reisen, meistens mit unserem „Adria-Bus“; 2014 und 2016 kamen vier
weitere Stents hinzu, drei sind noch geplant.
Mein soziales Umfeld kann man immer noch
als „äußerst reduziert“ einstufen, was ich gelegentlich bedauere, dessen
Merkmale aber dann auch wieder schätze.
Die Arbeit an diesem Dokument und mit dem
damit verbundenen Einblick in die ungeheure Daten- und Ereignisfülle von 78
Jahren hat u.a. die Erkenntnis gefestigt, dass man sich auf der „Zielgeraden“
befindet und das „Finale“ doch ungebremst näher rückt.
Trost eines Kollegen: “Jedes Finale kann
auch in die Verlängerung gehen“.
Na, dann!
|
Mutter |
Vater |
|
|
Rosatante |
|
Konrad, Rosa+Karl |
|
|
Sieghard+Rosatante (1942 auf dem Giglberg) |
August Krüger ("Augustonkel") |
|
Sieghard+Gudrun |
|
|
Helga+Gudrun |
Karo |
|
Elke |
|
|
|
Sarlkofel (Toblach) |
|
Sanella-Album |
Auf Bali |
|
A-Jugend (1957) |
|
|
An der Gänsweide |
Weidenbäume am Kohlbach im Wiesental |
|
Finni, Milan und Lasse |
Antje |
|
Lasse Koos |
Milan Koos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Richtfest 1971 (mit Walter+Kurt) |
|
|
|
Am Kohlbach |